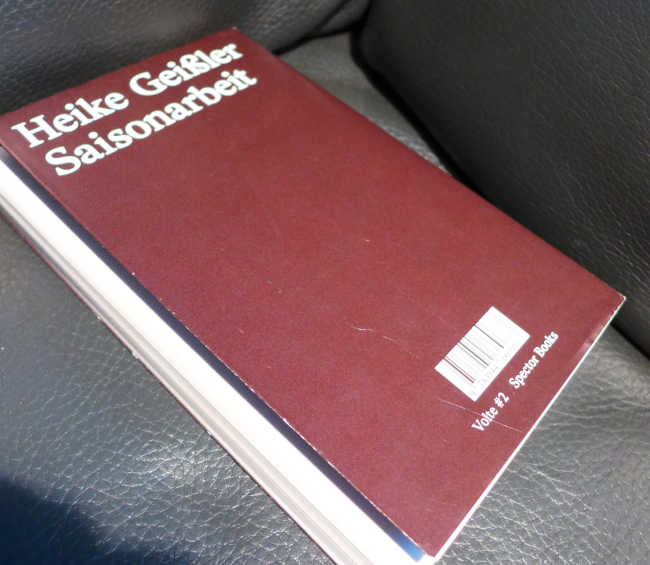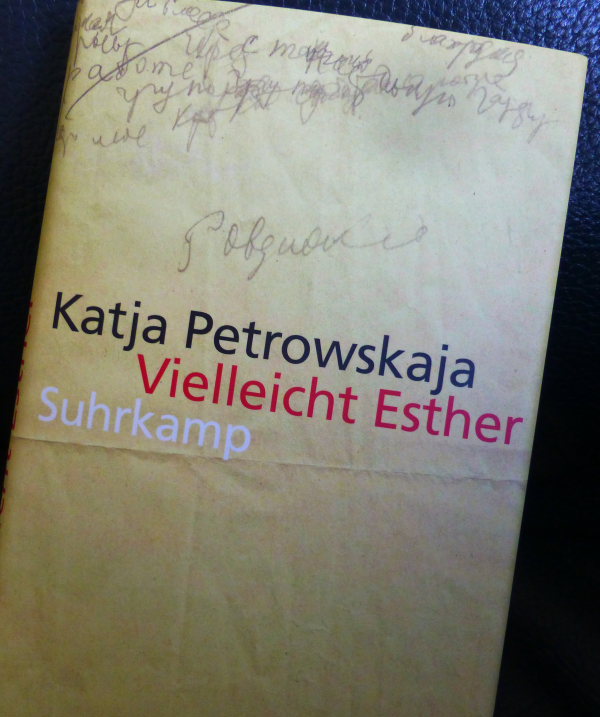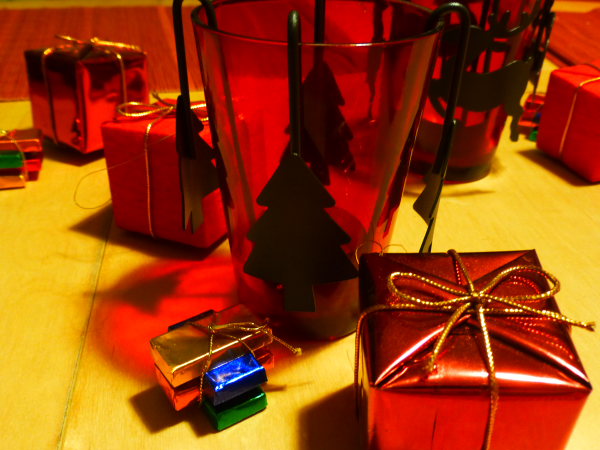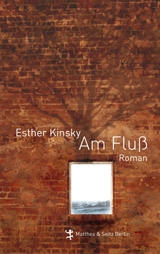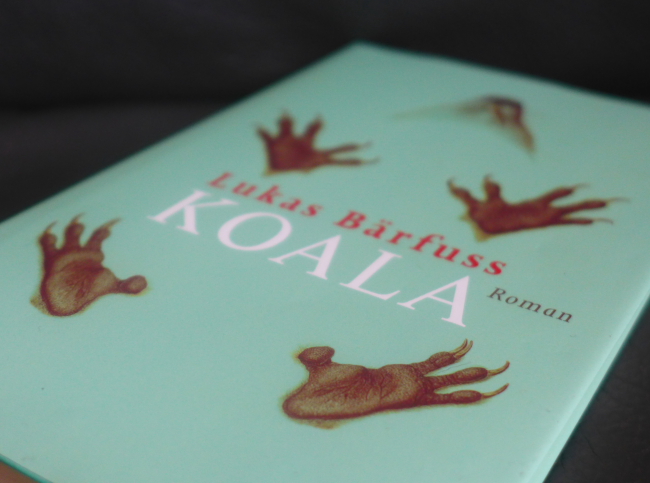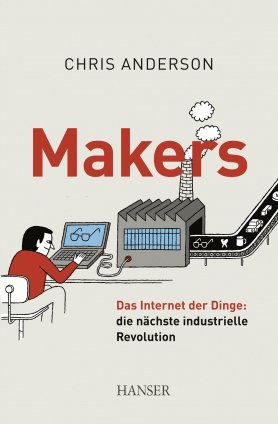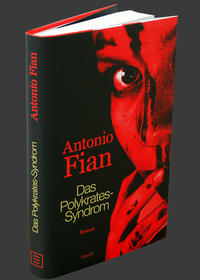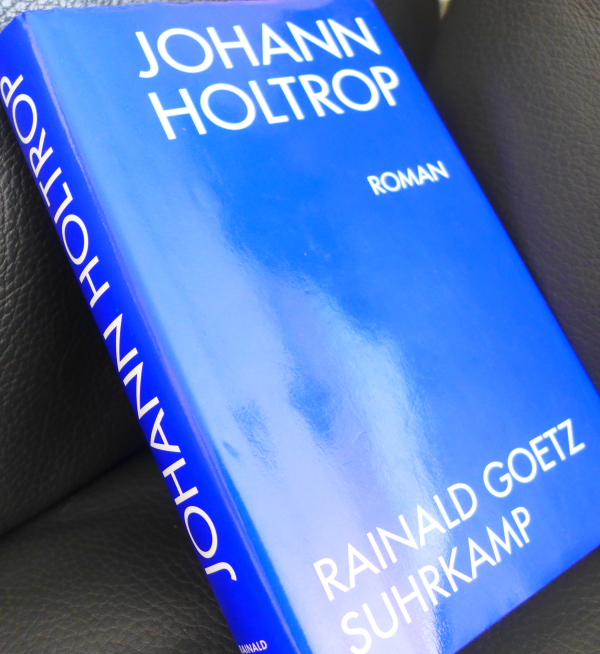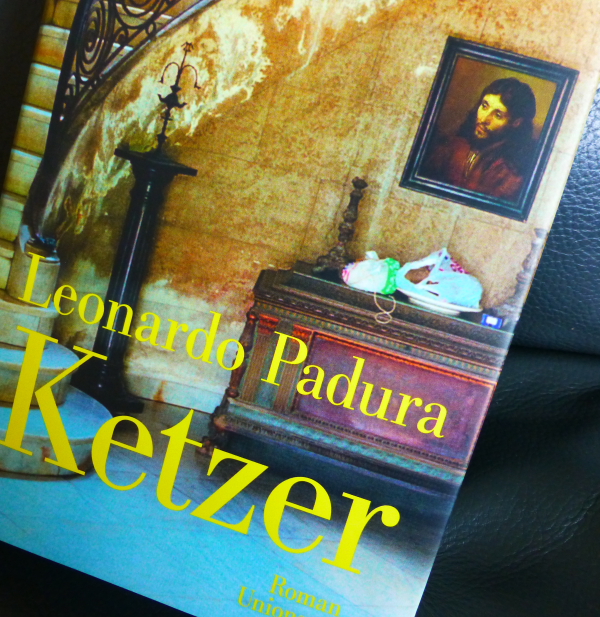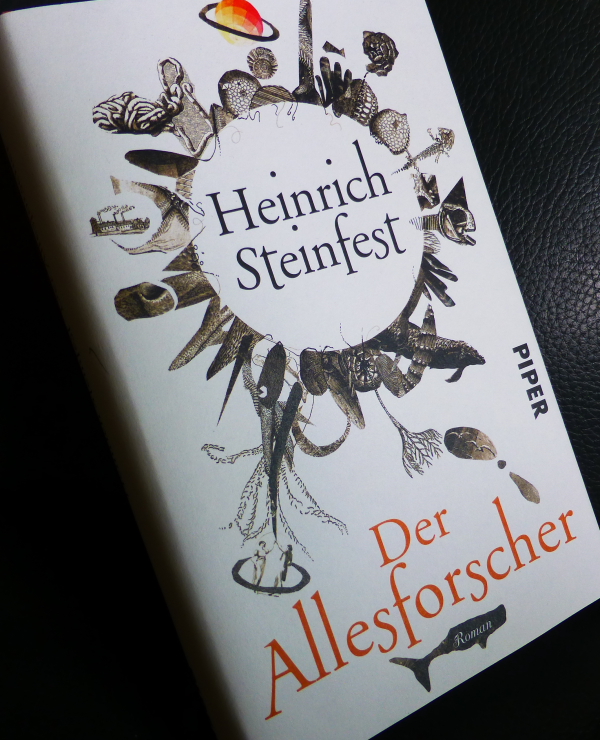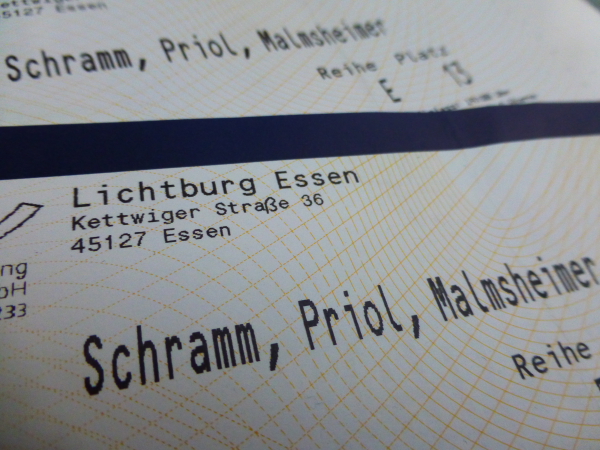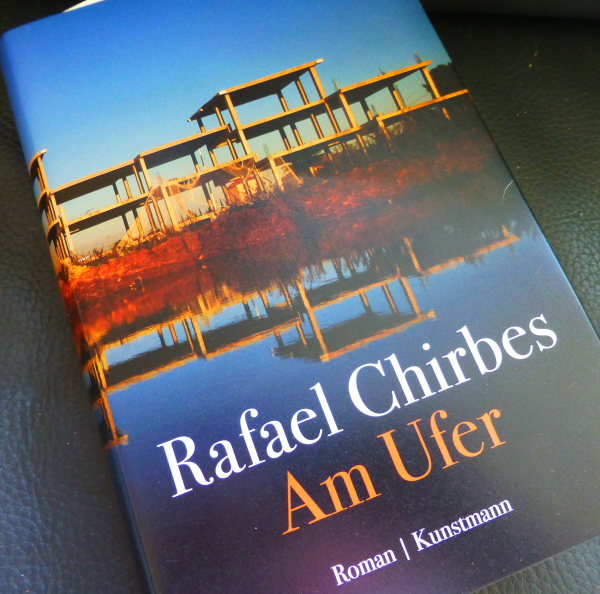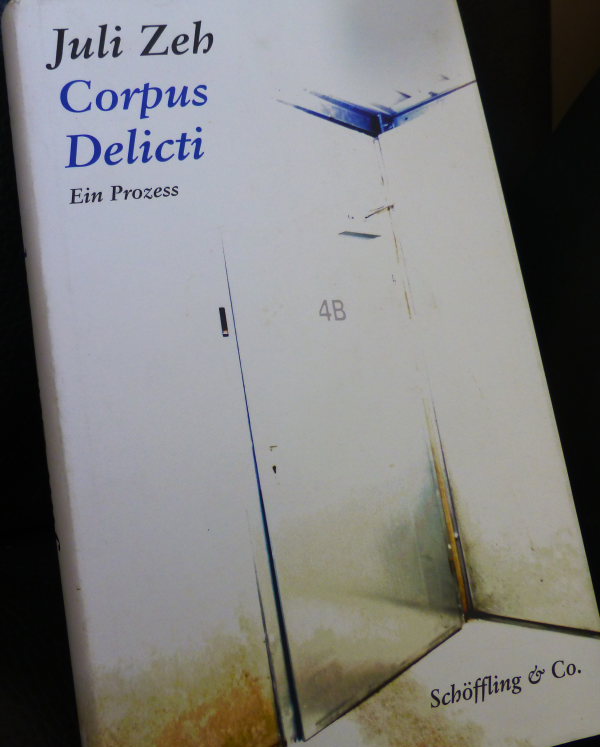Julia Trompeter studierte u.a. Germanistik und Philosophie, sie führt Sprechduette auf, weiß also um die Kunst der knappen (Gedicht-)Form und der Melodie der Worte, und hat nun ihren ersten Roman geschrieben. Im Roman erzählt eine Ich-Erzählerin, studierte Philosophin und leidenschaftliche Gedichtschreiberin davon, wie sie damit kämpft, einen Roman zu schreiben.
Julia Trompeter studierte u.a. Germanistik und Philosophie, sie führt Sprechduette auf, weiß also um die Kunst der knappen (Gedicht-)Form und der Melodie der Worte, und hat nun ihren ersten Roman geschrieben. Im Roman erzählt eine Ich-Erzählerin, studierte Philosophin und leidenschaftliche Gedichtschreiberin davon, wie sie damit kämpft, einen Roman zu schreiben.
Die Autorin also lockt den Leser charmant lächelnd in ein sehr doppelbödiges Spiel, voller literarischer und philosophischer Anspielungen, mit Gesellschaftsbeobachtungen, mit Liebesszenen natürlich, genauso wie es sich gehört in einem Roman, mit schonungsloser Selbstreflektion und der Entwicklung der Heldin – und sie lockt den Leser immer wieder auch in die Auseinandersetzung damit, was ein Roman alles darf, was er alles kann.
Das Ausgangsszenario ist schnell beschrieben: Die Ich-Erzählerin sitzt im Verlag der „Verlagsfrau“ gegenüber, hat ihr wohl etwas erzählt von der Geschichte, die sie gerne schreiben möchte über eine Literaturagentin, die sie immer die Mittlerin nennt, und nun macht die „Verlagsfrau“ der Erzählerin auf ruppige und entschiedene Art deutlich, was den Roman auszuzeichnen habe: Einen Plot brauche sie, „komme was wolle“, eine Vorgeschichte, in der die Figur der Protagonisten lebendig werde, am besten habe sie auch gleich etwas ganz Außergewöhnliches erlebt, und auf keinen Fall solle sie in Erwägung ziehen, irgendwie Thomas Bernhard in ihre Prosa einzubinden: „Wir bekommen jedes Jahr massenweise Manuskripte im Thomas-Bernhard-Stil.“ Komisch solle sie schreiben und bei allem beherzigen, was auch im Marketing gelte:
Wenn Sie überhaupt eine Chance haben wollen, dann müssen Sie sich von den anderen unterscheiden. Das sehe ich bei Ihnen momentan nicht.
Nach dieser deutlichen Ansage würden wohl viele Romanaspiranten sofort und auf der Stelle die Flinte ins Korn werfen. Daran denkt natürlich auch die Erzählerin. Sie müht sich überhaupt mit dem Gedanken, einen Roman zu schreiben, trifft sich aber immer wieder mit ihrer Mittlerin, die sie ihrerseits ebenfalls versucht zur Prosa zu überreden, schließlich habe sie doch dieses besondere Talent. Von Treffen zu Treffen bleibt die Erzählerin unentschlossen, ruft die Mittlerin sogar zwischen den verabredeten Terminen an, um ihr ein „nein“ entgegenzuschleudern und fiebert dann doch mehr und mehr dem Treffen mit der Mittlerin am kommenden Mittwoch entgegen.
Damit ist der Handlungsverlauf im groben schon skizziert, viel Action, viel Spannung gibt es im Alltag der Erzählerin eigentlich nicht, statt dessen mehr Nachdenken, mehr Beobachtung, mehr Reflektion und Assoziation. Ob die Erzählerin bis Mittwoch noch einen Plot findet für ihren Roman, bleibt lange unklar.
Allein der Alltag der Erzählerin schafft eine gewisse Handlung: die Treffen mit der Mittlerin, der abendliche Besuch einer Bar, in der die Erzählerin am Vortag noch mit der Mittlerin saß und in der sie nun einen jungen Mann anspricht, den einzig interessanten im Raum wie sie meint, einen Leser nämlich, der unglücklicherweise überhaupt keine Lust auf den erzwungenen Small Talk hat. Sie berichtet von ihrer Arbeit in einer Bäckerei, von vor Fett und Zucker triefendem Backwerk, dass dem Leser das Wasser nur so im Mund zusammenläuft, und ihrer Texterei in der Onlineredaktion. Mit knappen Skizzenstrichen macht sie die Zumutungen der modernen Arbeitswelt lebendig, zeigt uns den Prototyp des modernen Chefs, der Mitwirkung und Betriebsräte hasst und sich ansonsten als vorbildlicher Soziopath seine Autorität jeden Tag aufs Neue durch die Trias von Brüllen, Schmeicheln und Kündigen erwirbt. Sie schreibt über Maifeste, über Hotels und günstige Mietwagen, kurz, prägnant und vor allem: werbewirksam. Und plötzlich entdeckt sie Zusammenhänge zwischen ihrem Können als Lyrikerin und dem Texten der Teaser, nämlich nicht nur die Zusammenhänge der wirtschaftlichen Verwertbarkeit beider Textgattungen, sondern auch die sprachliche Finesse, die beiden Textformen eigen ist:
Vielleicht war der Unterschied dieser Teaser-Texte zu einem Gedicht weniger groß, als ich bis dahin gedacht hatte, da sich ja das Gedicht ebenfalls durch Kürze und Prägnanz auszeichnen sollte und den Leser zudem im besten Falle dazu anhalten sollte, den ganzen Gedichtband, so es denn einen zu kaufen gab, zu erstehen. Und zum ersten Mal fiel mir auf, dass ich der Job der Teaser-Schreiberin vielleicht gerade deswegen bekommen hatte. Deswegen nämlich, weil ich, aus meiner sonstigen Tätigkeit als Dichterin heraus, einen Umgang mit Sprache erlernt hatte, der mich zur Teaser-Schreiberin geradezu prädisponierte, da ich mich mit dem Aussieben, dem Feilen, dem Zurechtstutzen von Sprache ja einigermaßen auskannte – und es versetzte mir einen Stich, als mir bewusst wurde, dass ich seit mehreren Jahren jeden Montag einem vollkommen profitorientierten Unternehmen einen wichtigen Teil meines Talents, meines Könnens und meiner Persönlichkeit und damit ganz augenscheinlich meines Ergons in den Rachen warf. (S 137)
Diese Art des Erzählens steht im Gegensatz zu dem doch gewichtigen Hinweis, den die Verlagsfrau ihr gegeben hat, nämlich bloß einen großen Bogen um Thomas Bernhard zu machen. Doch davon lässt sich die Erzählerin überhaupt nicht beeindrucken. Bernhard geistert immer wieder durch ihren Text, seine Texte sind ihre Referenzen, seine Ideen und Gedanken regen sie zu Ideen und Gedanken, zur Auseinandersetzung an, fast sucht sie die Zwiesprache mit ihm. Diese Art des Erzählens ist sogar der direkte Bezug zu Bernhard, der in seinen Romanen seine Figuren ebenfalls in monologisierender Form erzählen ließ, der bekannt war für die kunstvoll verschachtelten Sätze, mit ihren immer wieder eigentümlichen Assoziationsketten. Und ganz in diesem Ton erzählt auch Ich-Erzählerin – man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Verlagsfrau darauf reagieren wird. Diese Art zu erzählen macht das Lesen manchmal anstrengend, es bedarf schon einer besonderen Konzentration auf den Text, aber auch immer wieder überraschend, weil wirklich keiner der gedanklichen Sprünge und Wendungen vorhersehbar ist, weil beinahe in jedem Satz eine merkwürdige Wendung vollzogen wird, manchmal ironisch wirkend, manchmal nachdenklich stimmend, jedenfalls ungewöhnlich.
Und während die Ich-Erzählerin uns ihre Tage bis zum nächsten Treffen mit der Mittlerin erzählt, ihre Auseinandersetzung mit der Idee, einen Roman zu schreiben, ihre Suche nach einem Plot, der doch mit der Mittlerin zu tun haben sollte, erschließt sie quasi so ganz nebenbei, was der Roman so alles kann. Er kann uns – natürlich – eine Geschichte erzählen, er kann ein Schlaglicht werfen auf die gesellschaftliche Realität, er kann uns eine Person nahebringen, ihre Gefühle, die sie so schön und praktisch in Spiegelsälen, Kellern und Verließen untergebracht hat, so nahe, dass wir sie gerne kennenlernen würden, sie vor allem aber sehr sympathisch finden. Und auch wenn er so ganz auf der Höhe der gesellschaftlichen Realität angesiedelt ist, kann er doch kurzerhand Welten erschaffen, die den üblichen Regeln nach nicht real sein können, was den Leser aber nicht weiter stört, er folgt willig und gönnt der Protagonisten jede merkwürdige Wendung. Und natürlich kann der den wunderbarsten Zeigefinger erheben und mit ganz viel Lust an der sprachlich geschliffenen Kritik zum Beispiel darüber nachdenken, wie das Verhältnis von Körper und Geist in unserer Gesellschaft immer wieder ganz falsch gedeutet wird, wenn aus dem Übergewicht eines Menschen auf dessen psychische Gesundheit geschlossen wird:
Und damit es zwischen diesen [dem Körper und dem Geist] wieder eine gewisse Entsprechung gibt, kann der moderne Mensch entweder viele kleine bunte Pillen schlucken oder, wenn das nicht hilft, einfach die nächsten zwanzig Jahre lang meditieren.
Damit die Schlichtheit der dahinter stehenden Erkenntnis nicht allzu deutlich zutage tritt, verpacken manche Mediziner ihre Weisheiten gerne hinter endlosen Analysen und schwammigen Diagnosen und völlig belanglosen Prognosen. Immer, wenn niemand, auch nicht der Chefarzt, dessen Name Programm und dessen einziges Programm sein Name ist, weiterweiß, benutzen sie das Wort Formenkreis. Der Patient leidet unter irgendeinem Blabla aus dem sowieso Formenkreis. (S. 188)
Man kann sich vorstellen, dass die Ich-Erzählerin, wenn sie denn diese so treffenden Formulierungen erdenkt, ihre eigene Entwicklung und die Entwicklung ihres Romans ordentlich befeuert. Und die Mittlerin? Die Mittlerin, die mit ihrem quietschenden Fahrrad, dem kleinen Kind und dem verdammt gut aussehenden Ehemann, der so gerne Köfte isst und deshalb von der Erzählerin konsequent Köfte-Belmondo genannt wird, vielleicht auch ein bisschen das Leben verkörpert, das die Ich-Erzählerin gerne hätte, sie vermittelt ganz offensichtlich den fertigen Roman nicht nur an einen Verlag, sondern ist vor allem diejenige, die der Erzählerin hilft, einen Roman auf die Beine zu stellen. Die Mittlerin also mehr noch eine Hebamme dieses literarischen, dieses sprachlich überzeugenden Spiels.
Julia Trompeter (2014): Die Mittlerin, Frankfurt am Main, Schöffling & Co
Eine weitere Besprechung findet Ihr hier.