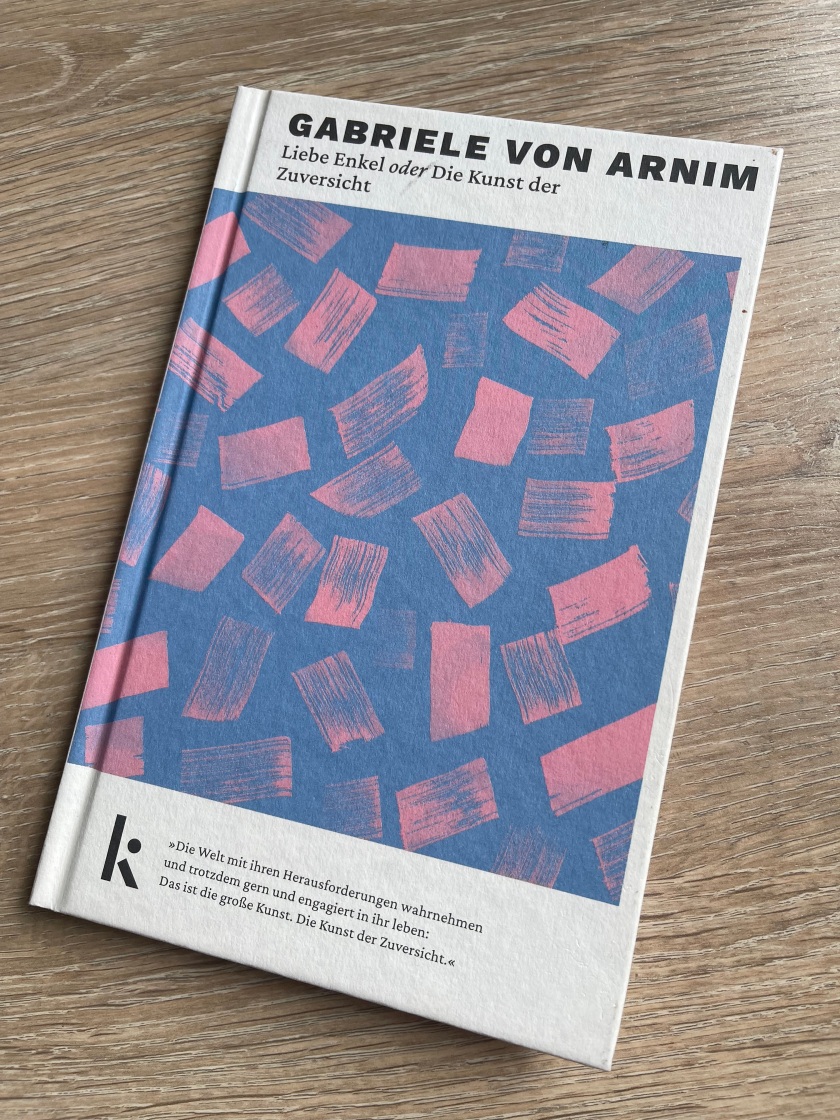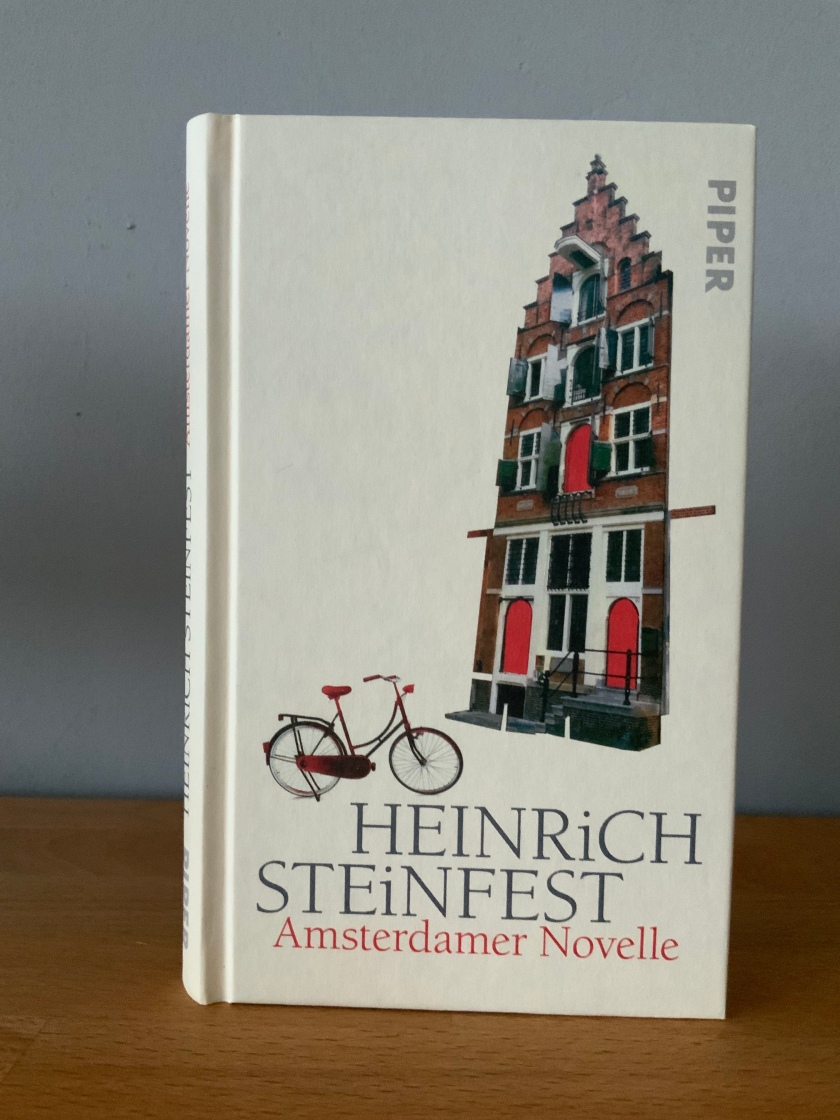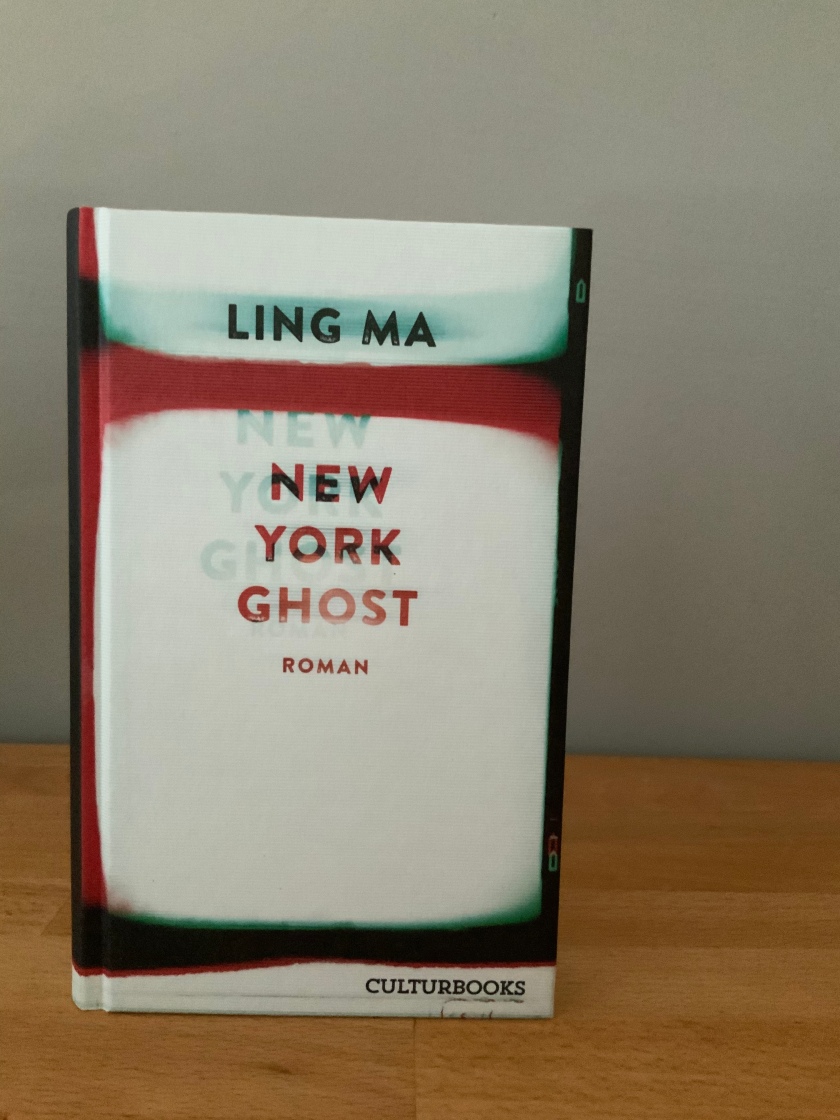In Philip Roth´ Roman „Der menschliche Makel“ ist es Professor Coleman Silk, der sich, als Schwarzer mit sehr heller Haut auf dem Bewerbungsbogen der Navy als „weiß“ bezeichnet. Niemand stutzt, niemand stellt seine Zugehörigkeit in Frage. So lebt er das Leben eines weißen Professors an einer Universität, wird gar Dekan, hat eine große Familie. Nun, 71-jährig und bereits emeritiert, lässt er sein akademisches Leben mit einigen Lehrveranstaltungen langsam ausklingen. Und spricht dort, weil zwei Studentinnen häufig fehlen, von ihnen als „dunkle Gestalten“. Es sind die 2000er Jahre, in denen solche Bemerkungen schnell den öffentlichen Furor anheizen und zu unangenehmen Problemen führen können, zumal wenn die, über die gesprochen wird, tatsächlich People of Color sind. Ausgerechnet Coleman Silk strauchelt also über diese Bemerkung. Seine Kolleg*innen in der Fakultät lassen ihn fallen, seine Frau stirbt bei den Aufregungen.
Trotz der offensichtlich ungerechten Verurteilung durch sein Umfeld offenbart Coleman Silk seine wahre Identität nicht. Wir Leser*innen ahnen, welche Hürde Silk einst genommen hat, wir ahnen, welche Kraftanstrengung es gewesen sein muss, in der weißen Gemeinschaft zu leben, ständig aber befürchten zu müssen, enttarnt zu werden. Wir ahnen, dass die Lüge so ungeheuerlich ist, dass er die Wahrheit nun nicht mehr aufdecken kann.
Auch Brit Bennett erzählt eine Geschichte vom Passing. Aber sie erweitert den Erzählraum, indem sie nicht nur von der Figur erzählt, die von der einen Hautfarbe und Kultur zur anderen wechselt, sondern auch die Familienmitglieder mit einbezieht, die Schwester, die Tochter, die Nichte. So gelingt ein vielschichtiger Blick auf die Frage, welche Konsequenzen der Identitätswechsel für die Figuren hat – auch über die Generationen hinweg.
Als Ausgangspunkt ihrer Geschichte hat Bennett eine fiktive Kleinstadt erschaffen. Es ist Mallard im Bezirk St. Landry, westlich von New Orleans. Dort hatte Alphonse Decuirs 1848 die Idee, eine Stadt zu gründen, in der nur Menschen leben sollten, die waren wie er.
„Nun, da der Vater tot und er befreit war, wollte der Sohn auf diesem Land etwas bauen, das die Jahrhunderte überdauerte. Eine Stadt für Menschen wie ihn, die nie als Weiße akzeptiert werden würden und sich trotzdem nicht wie Negroes behandeln lassen wollten. Einen dritten Ort. Seiner Mutter, Friede ihrer Asche, war seine Hellhäutigkeit verhasst gewesen; als Kind hatte sie ihn in die Sonne gestoßen und ihn angefleht, doch nachzudunkeln.“
Und in diesem Ort, in den 1938 ein Priester aus Dublin geschickt wurde, der sich wunderte über die hellen, teils blonden oder rothaarigen Menschen, obwohl im doch gesagt worden war, dass er Dienst in einer Stadt mit Farbigen tun solle, werden in eben jenem Jahr die Zwillinge Desiree und Stella Vignes geboren, die Ururururenkelinnen von Alphonse Decuirs. Hell ist ihre Haut, wie ein Ei dem anderen ähneln sie sich. Und doch haben sie ganz unterschiedliche Temperamente. Desiree ist die unruhige, die, die Stella hinter sich her zieht. Und Stella ist die, die die Hand der zappeligen Schwester nimmt und sie beruhigt. Sie sind, so denkt eine Nachbarin über die beiden kleinen Mädchen, ein einziger Mensch, der auf zwei Körper verteilt ist. Später dann, als sie heranwachsen, ändert sich das. Die Menschen in Mallard können die Zwillinge problemlos auseinander halten, Desiree ist weiter die unruhige, die aber auch die Verantwortung der sieben Minuten jüngeren Schwester gegenüber spürt. Und Stella ist blitzgescheit und wird aufs College gehen, wenn ihre Mutter das Geld dafür zusammenbekommt. Sie wirken nicht mehr wie ein Mensch, der sich auf zwei Körper verteilt, sondern mehr „wie zwei in einem, und jede zerrte in eine andere Richtung.“
Als die Zwillinge 16 Jahre alt sind, verschwinden sie in der Nacht nach dem Stadtfest. Sie hauen ab nach New Orleans, wollen nicht mehr für die Weißen im Nachbarort putzen und wollen der Enge der Kleinstadt entkommen. Sie finden Arbeit in einer Wäscherei, haben bald genügend Geld beisammen, um sich eine eigene Wohnung leisten zu können. Aber dann verliert Stella den Job in der Wäscherei. Alleine kann Desiree den Lebensunterhalt für die beiden nicht verdienen, das Leben in der Stadt ist teuer. Da schreibt das Kaufhaus Maison Blanche eine Stelle im Sekretariat aus. Und Stella bewirbt sich, wohl wissend, dass sie dort keine Farbige einstellen.
Also macht sie im Bewerbungsbogen mutig das Kreuz bei „weiß“ – und bekommt die Stelle. Fortan macht sie sich morgens nicht nur auf den Weg zur Arbeit, sondern auch in die Welt der Weißen. Und kehrt abends wieder zurück zu ihrer Zwillingsschwester in die Welt der Schwarzen. Und dann kommt Desiree eines Tages nach Hause und sieht, dass Stella verschwunden ist, alle ihre Sachen hat sie zusammengepackt. Desiree wird sie nicht wieder finden. Beim Zerren in die beiden Richtungen ist die Verbindung zwischen den Zwillingen nun tatsächlich unterbrochen. Und es wird Jahre dauern, bis sie wieder etwas über Stella erfährt.
Brit Bennett hat ihren Roman angelegt wie ein Experiment. Die Zwillinge, natürlich eng miteinander verbunden, sind so hellhäutig, dass der einen der Schritt in die weiße Kultur gelingt, während die andere in der Schwarzen bleibt. Sie, Desiree, heiratet sogar den dunkelsten Mann, den sie kennt und bringt eine Tochter zur Welt, die so schwarz ist, dass die Menschen in Mallard sie als „rabenschwarz“ bezeichnen, als „blauschwarz“ und „wie aus Afrika eingeflogen.“ Indem sie die Zwillinge in diesen von einander getrennten Kulturräumen leben lässt, spürt sie der Frage des Verlustes auf der einen Seite und der Identität auf der anderen Seite nach.
Denn die Entscheidung für „Schwarz“ und „Weiß“ bedeutet, keine Kontakte mehr haben zu dürfen, für Stella auch, sich von ihrer Herkunft mit allen Facetten, die dazugehören, rigoros zu trennen. Denn sie steht immer – darin ähnelt ihre Lebensumgebung der von Coleman Silk – vor dem Problem, irgendwo doch erkannt, irgendwie doch enttarnt zu werden. Da ist auch die Geburt eines Kindes ein großes Wagnis, denn sie weiß nicht, welche Hautfarbe es haben wird, ja, welcher Art die Haare sind. Kennedy, Stellas Tochter, wird mit so heller Haut geboren, mit solchen blauen Augen, dass sie schon fast violett erscheinen, sodass kein Verdacht auf Stella fällt.
Auch wenn die einzelnen Lebenswege der Figuren plausibel, ihre Entwicklungen und Entscheidungen nachvollziehbar sind und die Frage nach der Identität auf verschiedenen Ebenen erzählt wird, so schafft es Bennett nicht, die Geschichte so organisch zu erzählen, dass nicht immer wieder auch die Konstruktion der Erzählung erkennbar wird. Das Experimentelle der Ausgangssituation der beiden farbigen Zwillinge mit der weißen Haut, die die Möglichkeit eröffnet, solche völlig unterschiedlichen Entscheidungen treffen zu können, ist doch immer wieder sichtbar. Und setzt sich bei den Töchtern fort, von denen die eine so schwarz ist, dass sie auch in Mallard übelsten rassistischen Beschimpfungen ausgesetzt ist, während die Cousine in Los Angeles so strahlend weiß ist. Und so trägt die Konstruktion, die von den Zwillingen zunächst in 10-Jahres-Schritten 1968 und 1978 erzählt, in den 1980 Jahren nicht mehr. Hier franst die Erzählung der Töchter Kennedy und Jude aus.
Die unterschiedlichen Sprachebenen, die Dialekte, die im Original möglich sind, haben es nicht in die Übersetzung geschafft. Einmal fragt Desiree ihre Schwester Stella, wie sie denn spreche. Das ist bei Stellas einzigem Besuch bei Schwester und Mutter in Mallard und sie ist schon Dozentin für Mathematik an einem College. Aber, so berichten die Mitlesenden meines Leseklubs, in der englischen Version seien die kulturellen Räume auch sprachlich zu erkennen. So ist die recht konventionelle Art des Erzählens wohl der Übersetzung geschuldet.
Die Geschichte der vier Frauen erzählt Bennett aus deren jeweiliger Perspektive und nahezu chronologisch. Keine der vier Frauen erlebt eine Katastrophe vom Ausmaß einer griechischen Tragödie, so, wie Philip Roth sie für Coleman Silk erdacht hat. Viel mehr als die Auswirkung der Lebenslüge Desirees zu erforschen scheint Bennett zu interessieren, wie die vier Protagonistinnen sich in ihren Leben zurechtfinden, welche (inneren) Schwierigkeiten sie bewältigen, um ihren jeweils eigenen und selbstbestimmten Weg zu finden. Und das ist eine große Stärke des Romans.
Dabei ist der Rassismus, der immer wieder aufscheint, der immer wieder Steine in den Weg legt und Chancen zunichtemacht, nur eines der Konfliktfelder, denen die vier Frauen ausgesetzt sind. Denn jede von ihnen muss auch für sich selbst und unabhängig von der Frage der Hautfarbe entscheiden, welche Interessen und Fähigkeiten sie haben, welche Wege sie einschlagen wollen, wer sie sind. Im Vergleich also zum tragisch stürzenden Helden, dem am Lebensabend alles genommen wird, was er sich sein Leben lang aufgebaut hat, erkundet Bennett mehr, welche Möglichkeiten die Figuren haben, ein eigenständiges, ein glückliches Leben finden zu können. Da schwingt auf jeden Fall viel Hoffnung mit. Nicht zuletzt durch Reese, den Freund Judes, der auch seine Identität gewechselt hat, als er sich auf seiner Reise nach Los Angeles entschloss, endlich als Mann zu leben.
Eine Katastrophe ist aber auch in Stellas und Desirees Leben passiert. Und ist sicherlich auch der Grund für Stellas Lebensentscheidung. Noch Jahre später, da lebt sie schon das Leben als Weiße in Los Angeles, hat sie einen Baseballschläger hinter dem Bett versteckt. Eines Abends nämlich, die Zwillinge sind noch klein, da schnitzt ihr Vater Leon gerade ein Tischbein, als fünf Weiße sie im eigenen Haus überfallen. Sie treten die Haustüre ein und bringen den Vater nach draußen und lesen ihm die von ihm angeblich verfassten unschicklichen Briefe an eine weiße Frau – Leon ist Analphabet – vor. Dann brechen sie ihm jeden Finger und jedes Gelenk. Viermal schießen sie auf ihn, aber er überlebt. Später suchen die Weißen im Krankenhaus nach Leon und vollenden dort ihr Werk durch zwei Schüsse in seinen Kopf.
Im Ort kann sich niemand erklären, warum dieser Lynchmord passiert ist. Vielleicht ist er einem weißen Handwerker mit einem zu günstigen Preis in die Quere gekommen, vielleicht hat er eine andere Regel übersehen. Ratlosigkeit geht über in Zynismus: so etwas passiert eben, ohne Grund, ohne Sinn.
„In Mallard – dieser seltsamen, abgeschiedenen Ortschaft – sollte man sich sicher fühlen in einer Gemeinschaft aus Gleichen.Aber selbst hier, wo niemand dunkelhäutig heiratete, war man noch immer farbig, und Weiße konnten einen umbringen, weil man nicht schon beim ersten Mal gestorben war.“
Beim Einbruch der Weißen haben Stella und Desiree sich im Schrank versteckt. Stella aber hat durch den Spalt der Tür gesehen, wie die Weißen den Vater hinausschleifen. Und hat für sich die Chance ergriffen, ein anderes Leben zu führen als das, was die Gesellschaft, eine Gesellschaft, in dem solch ein Verbrechen ungesühnt passiert, in der die Mutter dann kaum so viel Geld verdienen kann, dass es für die Schulbildung der Kinder reicht, für sie vorgesehen hat. Dafür zahlt nicht nur sie einen hohen Preis.
Brit Bennett (2020). Die verschwindende Hälfte, aus dem Englischen übersetzt von Isabel Bogdan, Robin Detje, Hamburg, Rowohlt Verlag