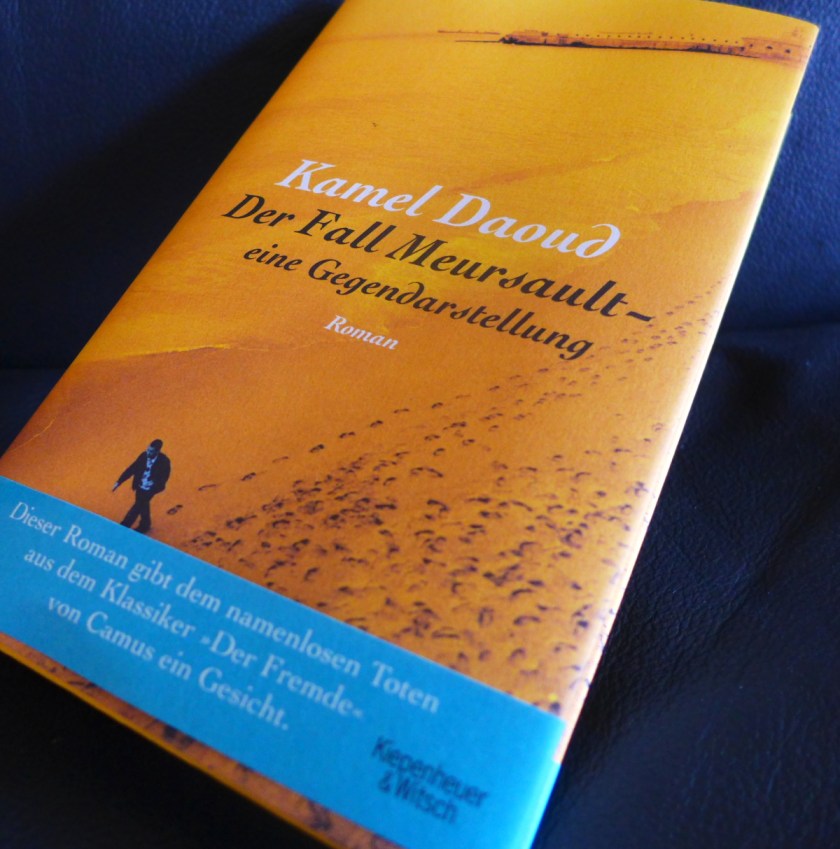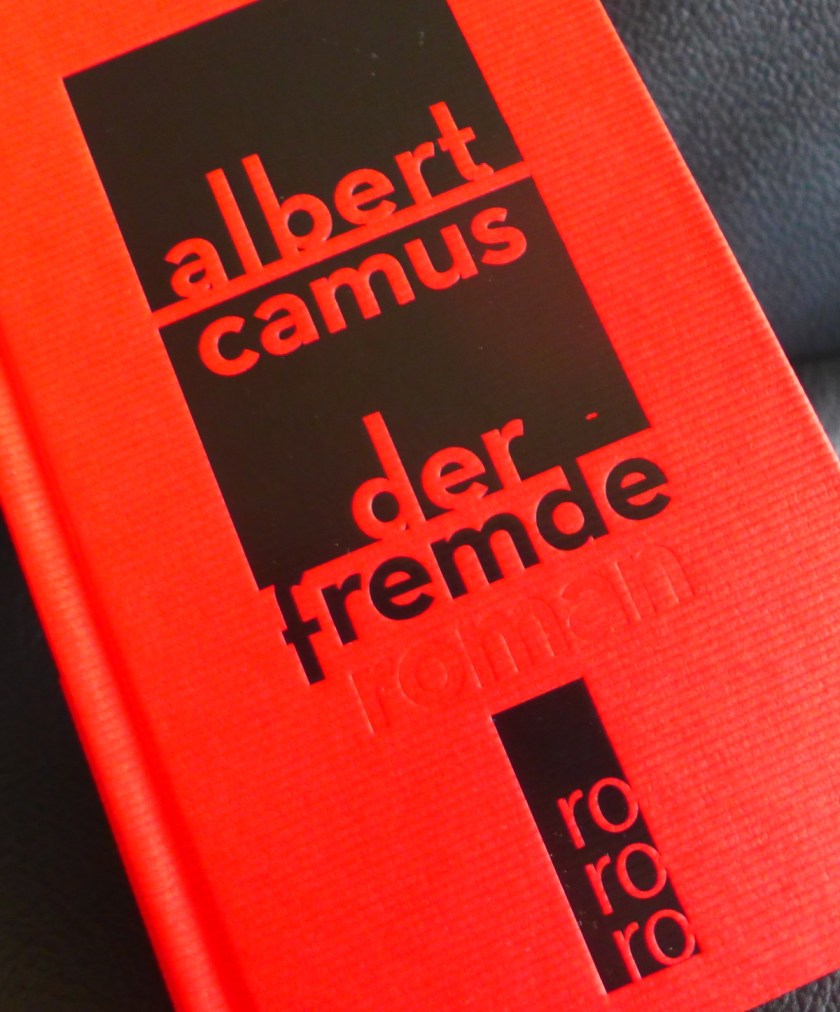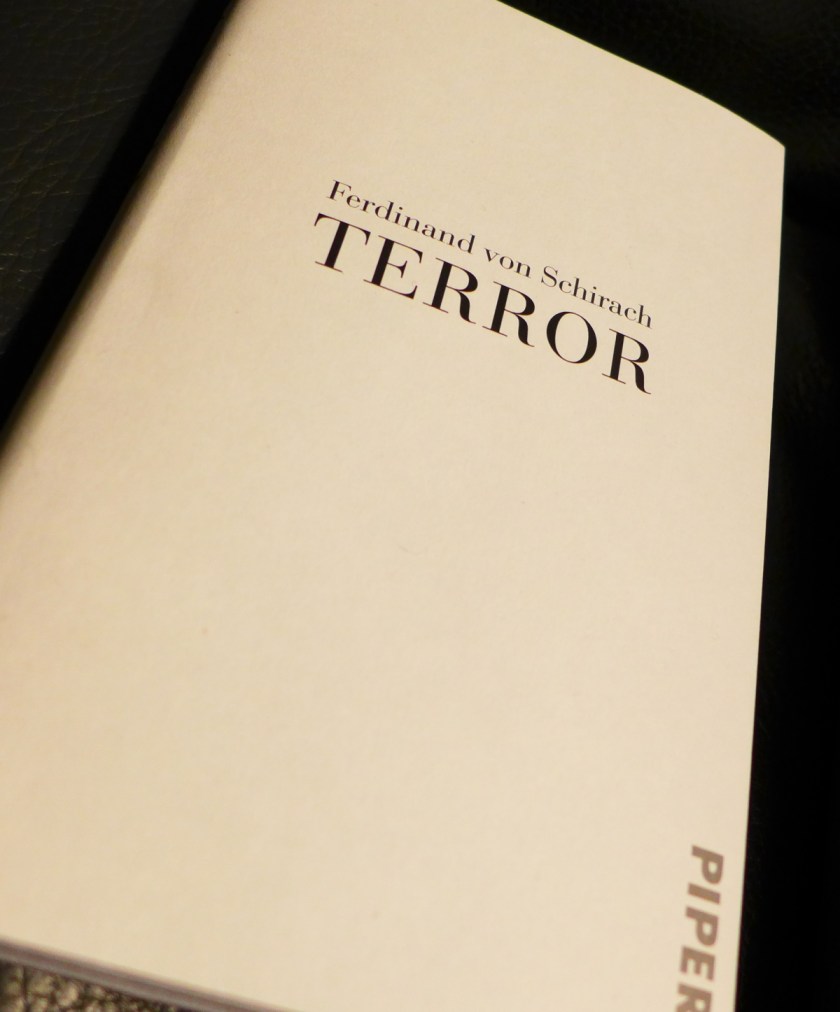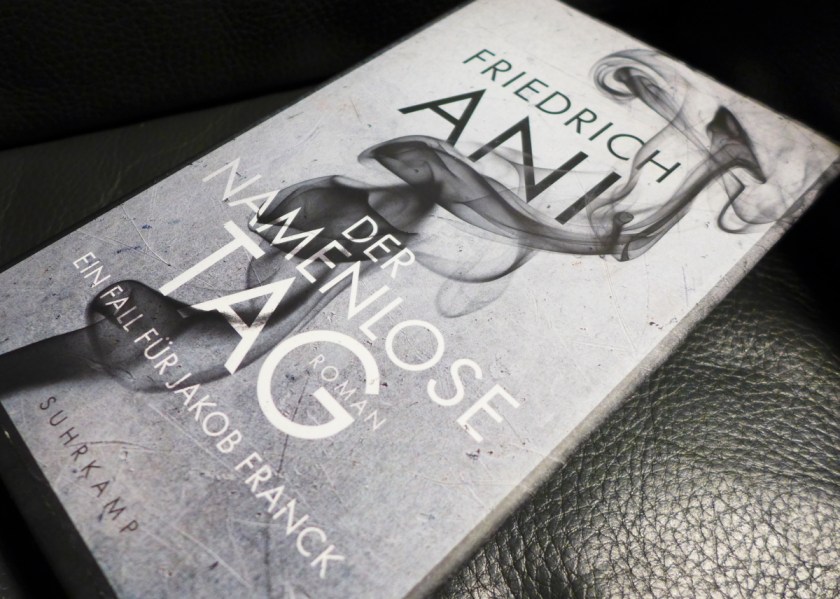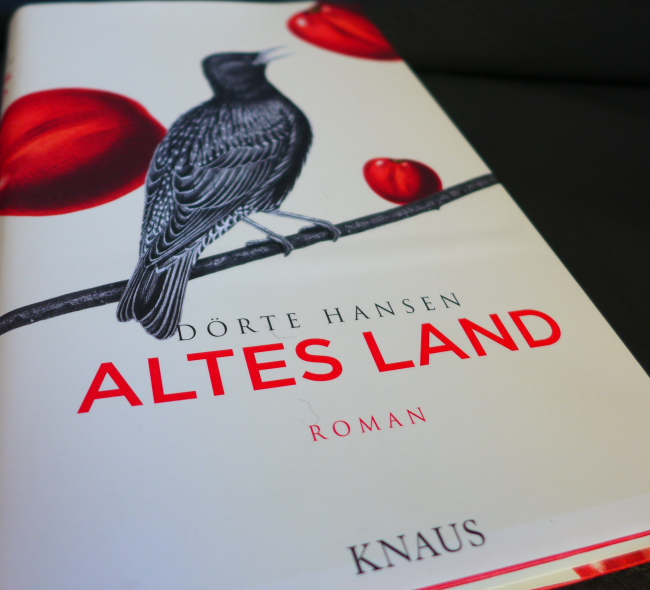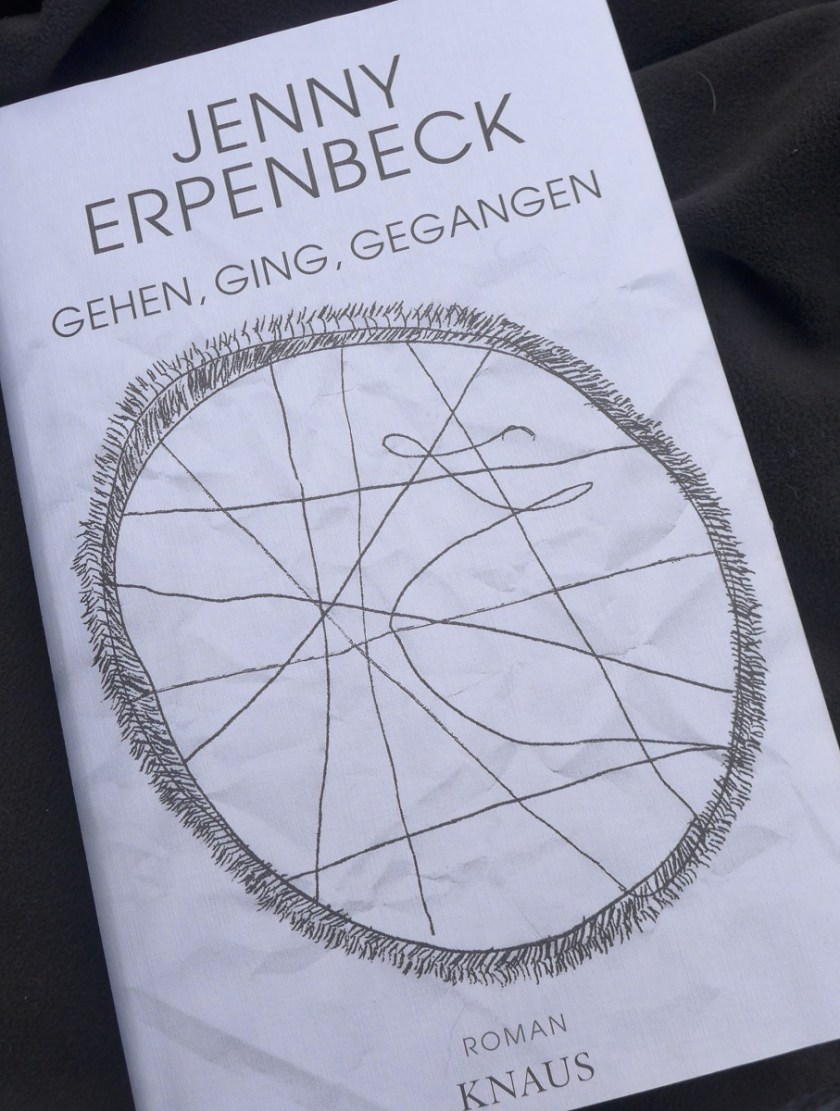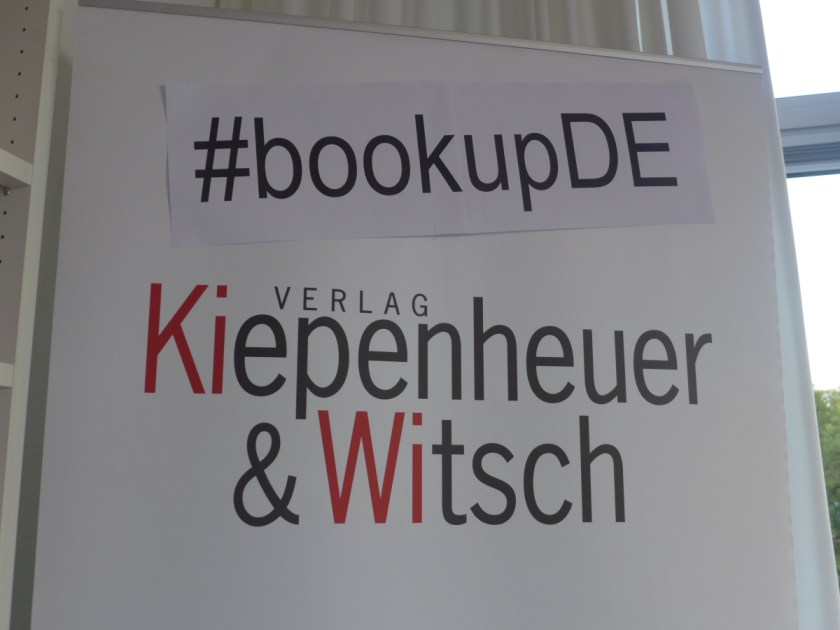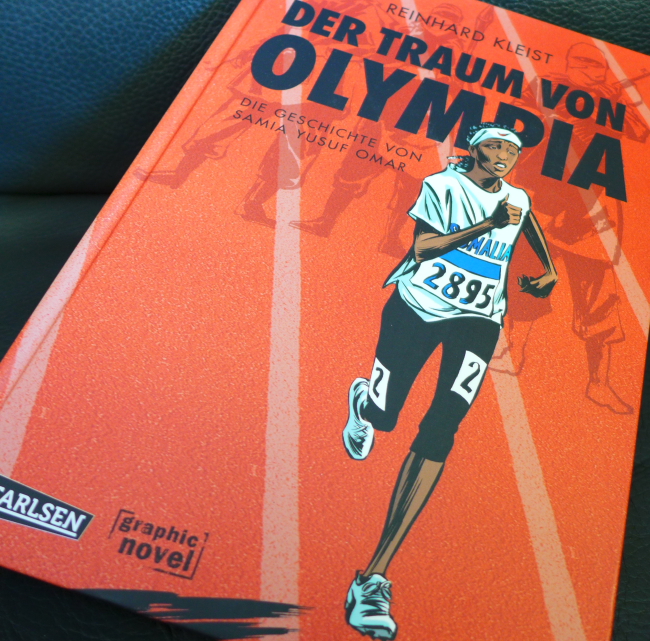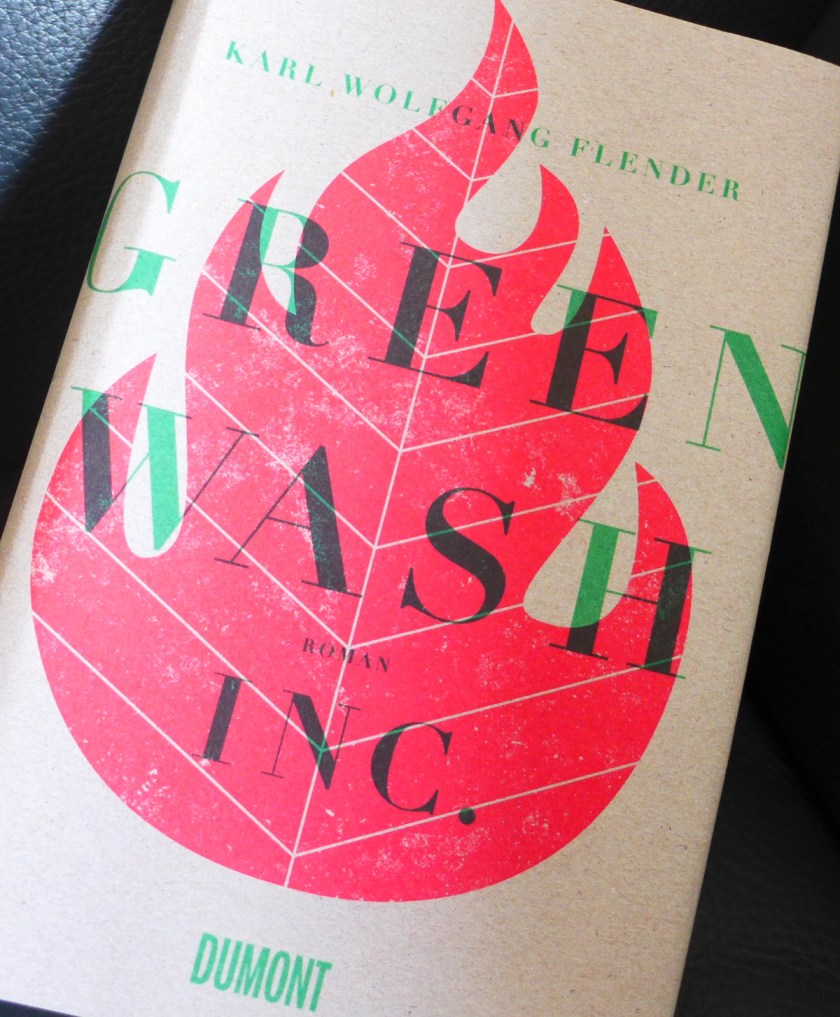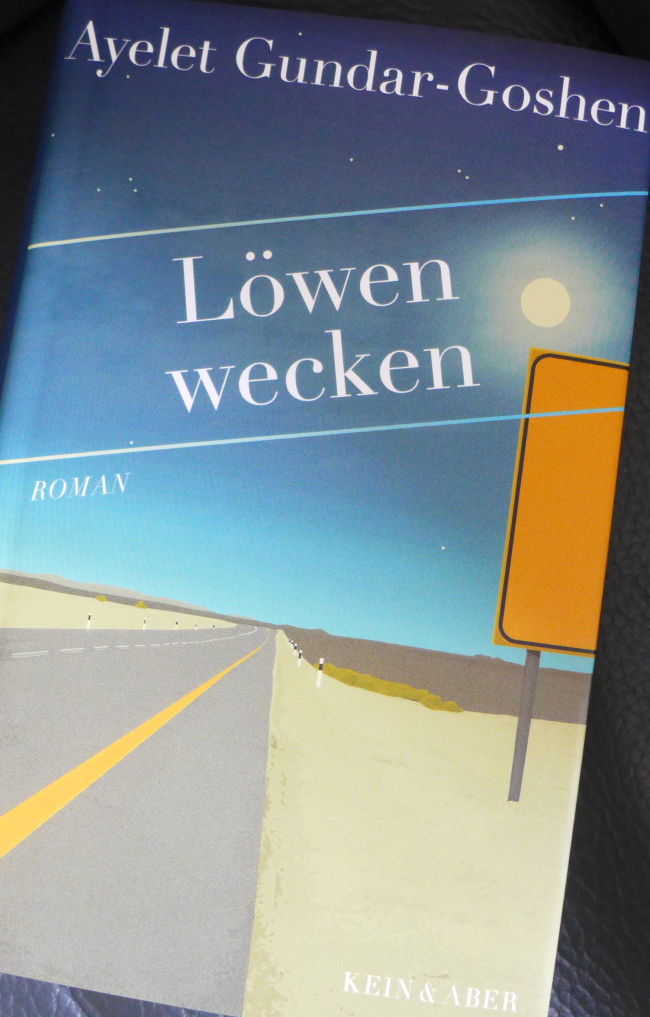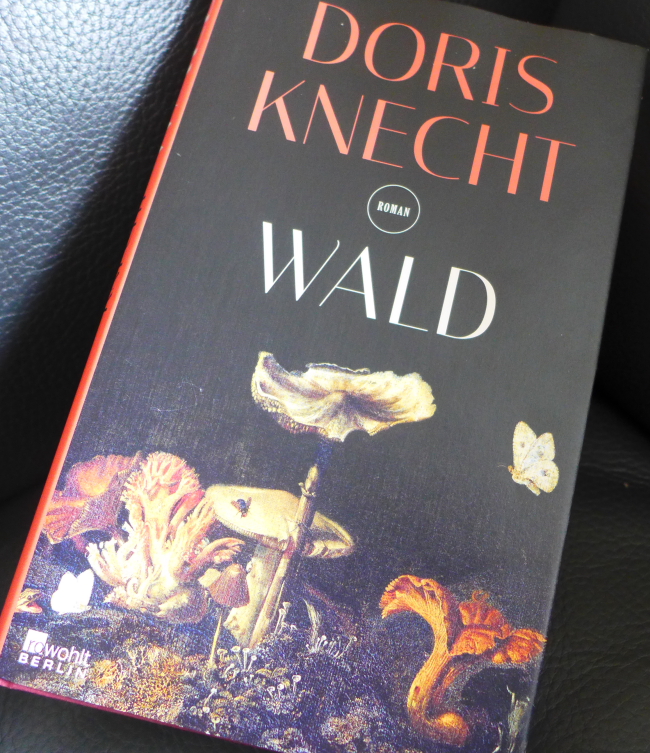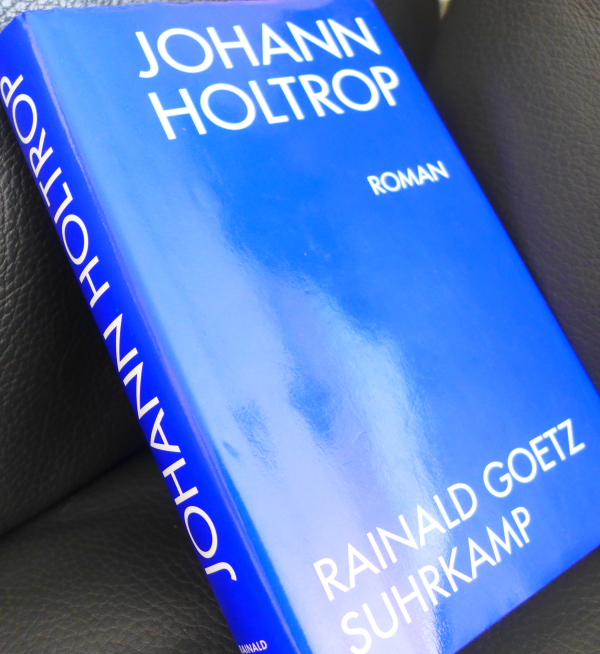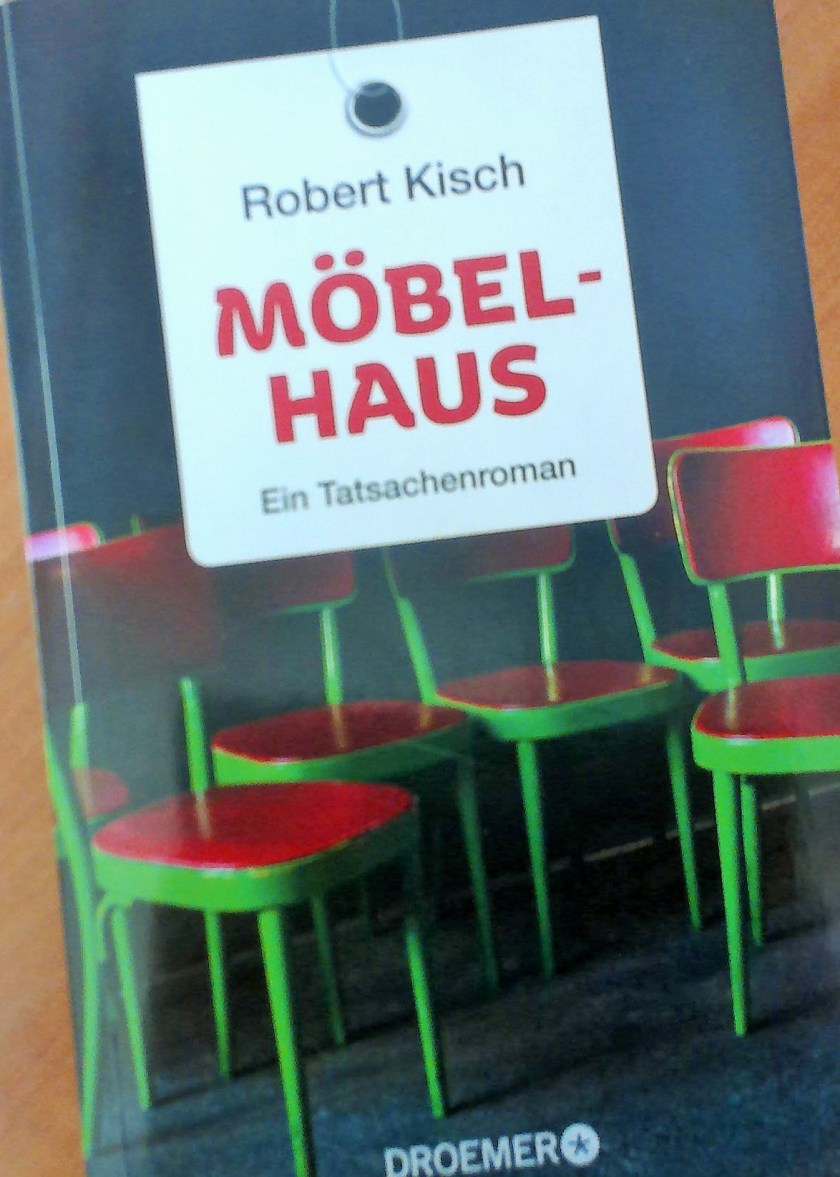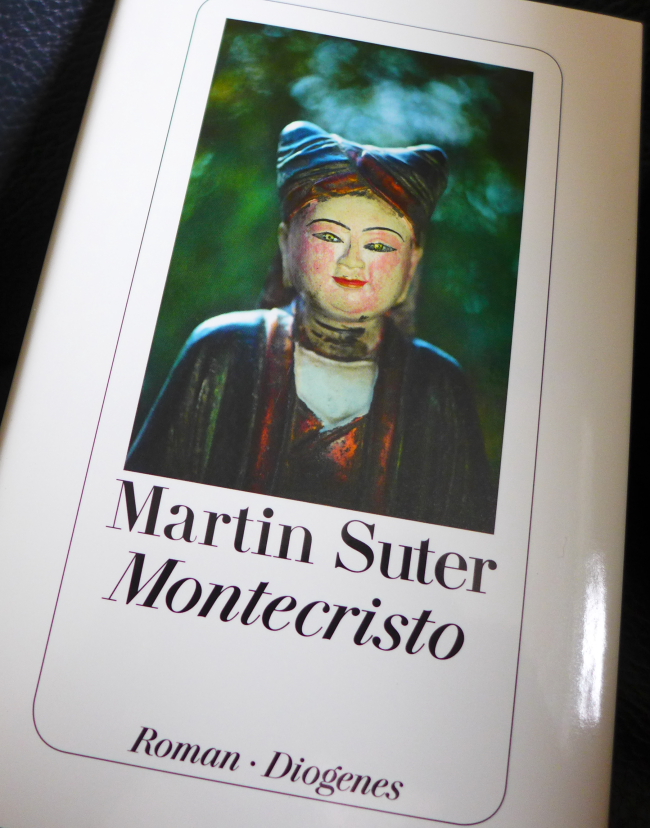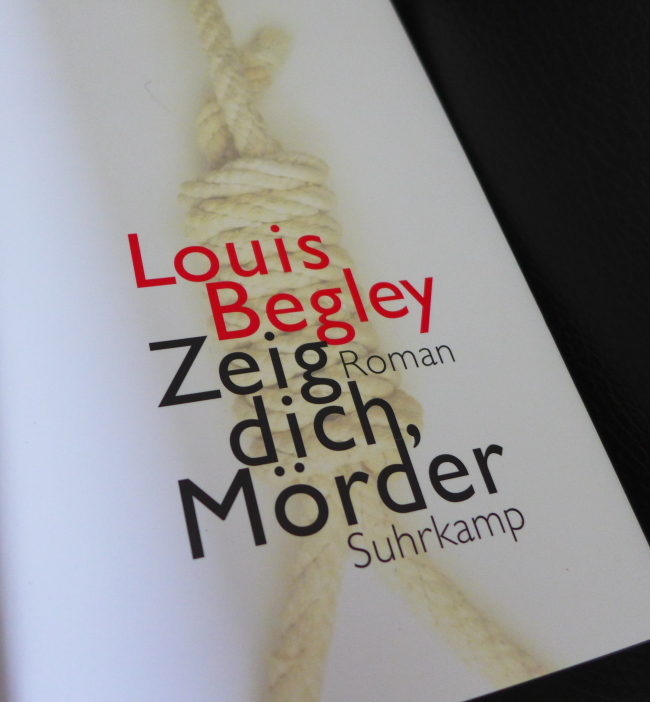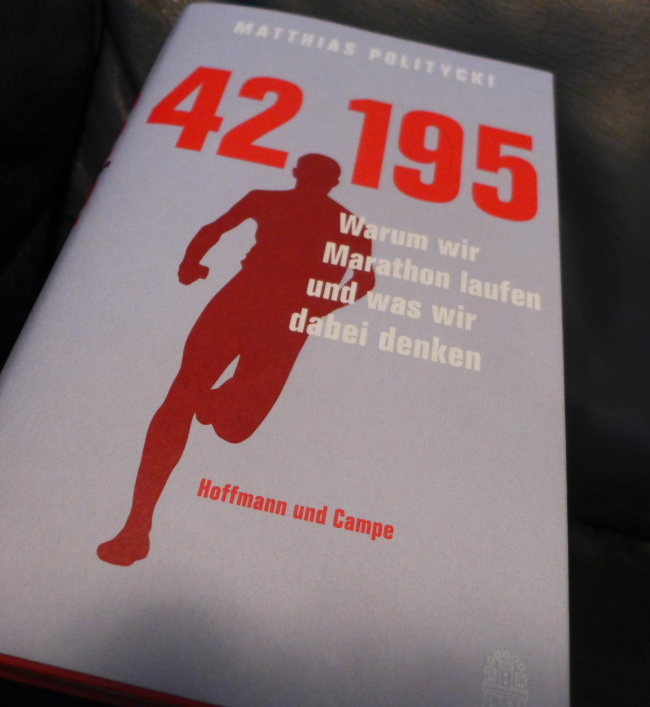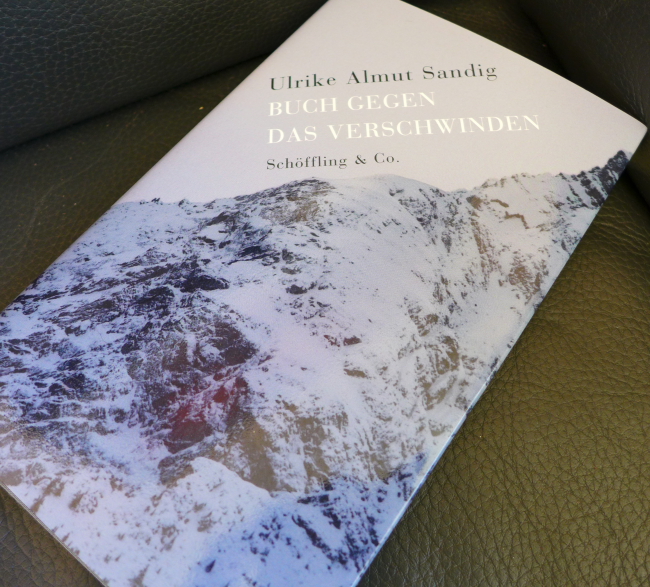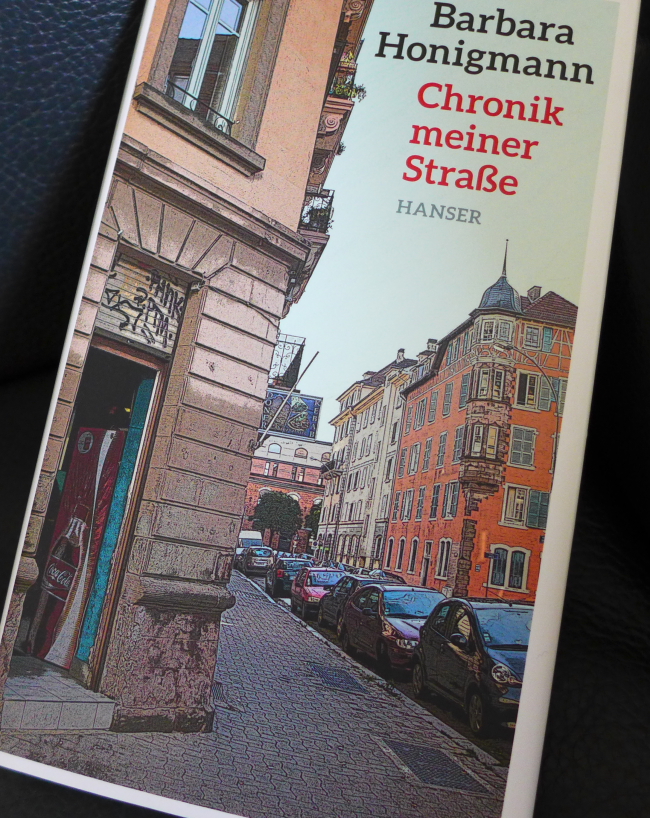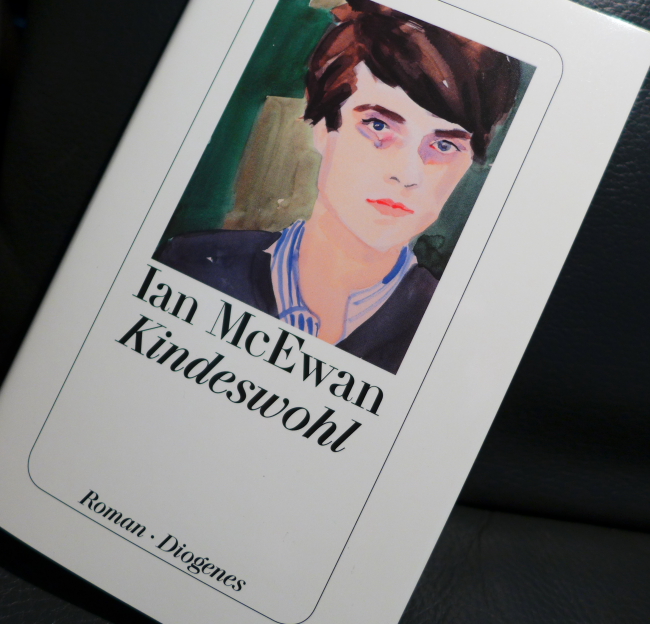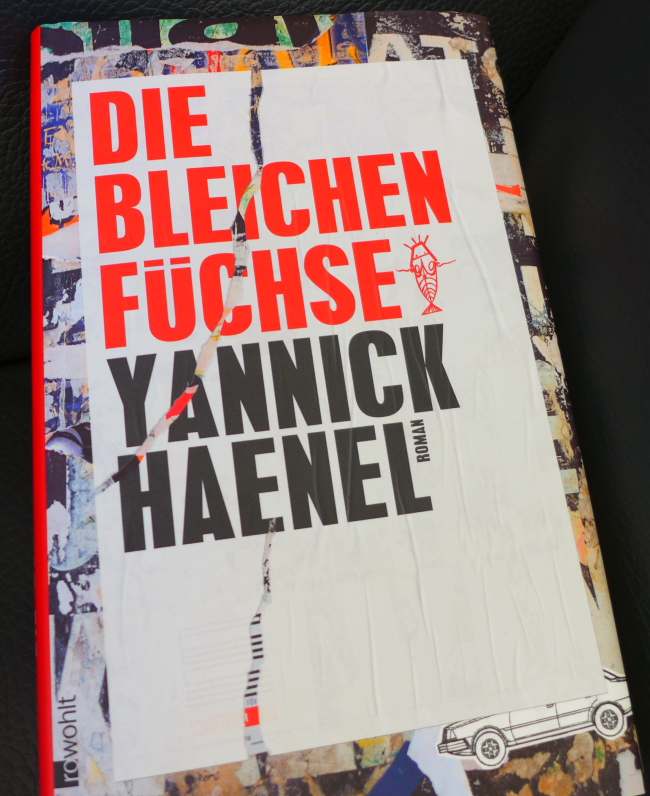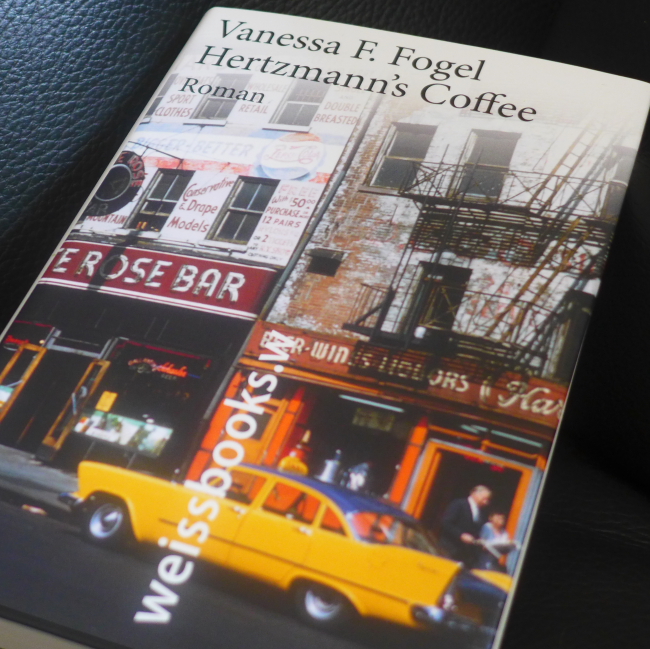Es gibt Stoffe in der Literatur, die durch die Zeiten immer wieder neu erzählt werden. Sie haben einen narrativen Kern, der quasi zeitlos ist, sie haben narrative Ränder, die immer in andere Zeiten und Räume transformiert werden können. Camus´ Roman „Der Fremde“ scheint solch ein Stoff zu sein. Die Urgeschichte lebt fort, findet seit siebzig Jahren begeisterte Leser, die Figuren und ihre Ideen finden Eingang in andere literarische Werke, werden zu Zitaten, zu Referenzen. Der Stoff selbst, die Handlung, die Motive, die Art des Erzählens inspiriert auch immer wieder Schriftsteller. So bleibt der sinnlose Tod des namenlosen Arabers natürlich nicht ohne Antwort in Algerien. Und nun hat auch Kamel Daoud, ein algerischer Journalist, sich mit dem Stoff in seinem Debütroman auseinandergesetzt. Nichts weniger als eine Gegendarstellung ist dabei herausgekommen, eine Sicht der Dinge aus der Perspektive des jüngeren Bruders des Ermordeten, der nun, als alter Mann, endlich erzählen möchte, wie die Tat für ihn war.
Jeden Abend sitzt Haroun in der Bar und trinkt seinen Wein. Er wartet seit Jahren schon auf den Zuhörer, der sich für seine Geschichte interessiert, der endlich kommt, um zu fragen, wie es damals war, vor siebzig Jahren, als Meursault an einem Strand von Algier einen Mann erschossen hat, einen Araber, von dem nicht einmal der Namen überliefert ist. Haroun hat Französisch gelernt, damit er die Geschichte seines Bruders endlich erzählen kann in derselben Sprache, in der auch der Mörder seine Geschichte aufgeschrieben hat. Damit sein Bruder endlich einen Namen bekommt, Moussa heißt er, und so der namenlose Araber eine Identität, damit endlich die Konsequenzen dieses absurden Mordes deutlich werden. Aber Haroun will die Sprache eben nicht so nutzen, wie sie der Mörder nutzt, so, als bestehe sie aus „von Hand behauenen Steinen“, mit Worten die „zu Mathematik werden“, die „sauber“, „präzise“, „eindeutig“ sind.
„Diese perfekte Sprache, die selbst der Luft etwas Diamantenes verleiht, ließ allen den Mund offen stehen, und sie haben ihr Mitgefühl für die Einsamkeit des Mörders ausgesprochen und ihm die gelehrtesten Beileidsbekundungen ausgedrückt.“
Nein, seine Geschichte müsse zwar auch im Französischen erzählt werden, aber „diesmal wie das Arabische, von rechts nach links“. Also werde er damit beginnen von seinem Bruder zu erzählen, von der Zeit, als er noch lebte und durch die Straßen ging, von seinem riesengroßen Äußeren, seinem Bart, seinen starken Armen und seiner Arbeit als Gelegenheitsarbeiter, als Mädchen für alles. Und er erzählt von seiner Familie, dem Vater, der sich irgendwann auf und davon gemacht hat und seine Frau und die beiden Söhne hat sitzen lassen. Eine Schwester haben sie nicht, wie Meursaults Erzählung es nahegelegt hat. Aber Haroun nimmt an, dass Moussa eine Freundin hatte, denn in der Nacht vor seinem Tod nennt er im Schlaf den Namen einer Frau, „Zoubida“. Und seine Mutter reagiert merkwürdig, so, als ahne sie, dass da eine Frau eine Rolle spielt für den älteren Sohn. Wenn es tatsächlich die Frau gewesen ist, die am Tag, als die Mutter mit Haroun Algier verließ, am Weg stand und ihnen nachschaute, dann ist es eine der Algerierinnen gewesen, die sich mit kurzen Röcken, festen Brüsten und blondgefärbtem Haar zwischen den Vierteln der Franzosen und der der Algerier aufhielten.
So also beginnt Haroun seine Geschichte. Als Monolog, den er dem Zuhörer in der Bar, als der wir Leser dort sitzen, erzählt. Eine mündliche Narration, assoziativ, sich manchmal wiederholend, sich nur lose an den Ablauf der Chronologie haltend, manchmal nach vorne springend, manchmal zurück. Eine Erzählung, in der die großen Fragen: „Wie konnte das passieren?“ und vor allem: „Warum musste das passieren?“, nicht geklärt werden können. Eine Erzählung aber, in der Haroun einen tiefen Einblick gibt in die Lebensbedingungen der Algerier in den Zeiten des Kolonialismus, in der er immer wieder deutliche Kritik übt, nicht nur an den Franzosen, auch an seinen Landsleuten, ihrer Religion und der engen Kultur. Und vor allem und in erster Linie eine Erzählung, in der er sein Leben beschreibt nach dem Tod des Bruders, dem völlig absurden Tod, nachdem die Mutter nach einer Phase der Wut in eine Phase einer „spektakulären“ Trauer wechselt, die ihr die Sympathie der Nachbarinnen einträgt, langfristig aber dazu führt, dass Haroun nicht ohne Schuldgefühle leben kann, dass die Mutter Haroun für ihre Trauer instrumentalisiert.
„Ich hatte das Gefühl zu leben, wenn ich auf der Straße war, in der Schule oder auf den Bauernhöfen, auf denen ich arbeitete, dann aber in ein Grab oder einen kranken Bauch zurückzukehren, kaum dass ich nach Hause kam. M´ma und Moussa warteten auf mich, jeder von beiden auf seine Art, und ich fühlte mich fast gezwungen, mich zu erklären und für die verlorenen Stunden zu rechtfertigen, in denen ich das familiäre Messer der Rache nicht geschliffen hatte.“
Haroun meint, er sei nicht wütend, er sei nicht traurig, aber er wünsche sich Gerechtigkeit. Trotzdem: seine Zusammenfassungen der Geschichte Meursaults zeigen schon seinen Zorn darüber, dass er nicht nur nicht wegen des Mordes verurteilt wird, sondern mit seiner perfekten Sprache auch noch alle seine Leser auf seine Seite ziehen kann. Die Todesstrafe wird dann auch nie vollstreckt. Für ihn aber, Haroun, habe mit dem Mord das erst wirklich absurde Leben begonnen.
So ist Harouns Darstellung seines Lebens tatsächlich eine Gegendarstellung, nämlich die Erzählung die dem Leben der Angehörigen des zweiten Toten, des Arabers, nachspürt und die Konsequenzen klärt, die der Mord für die Mutter und den kleinen Bruder haben. Gleich zu Beginn betont Haroun immer wieder die Bedeutung dieses zweiten Toten, von dem Meursaults Geschichte kein Wort erzählt, spricht davon, dass Meursault ihm doch wenigstens einen Namen hätte geben können, vielleicht „Vierzehn Uhr“, den Todeszeitpunkt. Auf Arabisch hieße er dann „Zoudj, die Zwei, das Duo, er und ich“.
Und es ist das Bild der „Zwei“, der Brüder, der Zwillinge, der zwei Seiten, das leitmotivisch durch den Roman führt. Denn so sehr Meursaults Tat sein Leben verändert, so sehr ist sie auch der Ausgangspunkt dafür, dass Haroun mehr und mehr der Zwilling wird von Meursault, sein „Doppelgänger“, sein „Spiegelbild“, dass sie werden wie „Kain und Abel“:
Haroun lernt eine Frau kennen, Meriem, die die Familie gesucht hat, weil sie über den Mord an dem Araber recherchiert hat. Sie zeigt Haroun und seiner Mutter zum ersten Mal das Buch, ein paar Mal trifft sie sich mit Haroun, erklärt ihm die Erzählung, dann bricht sie den Kontakt ab. Er hat sich verliebt und wartet noch Monate am Busbahnhof darauf, dass sie kommt. Danach aber verliebt er sich nie mehr.
Haroun lehnt die Religion ab, ja, ihm graut geradezu vor der Religion. Von den Gläubigen, die freitags zur Moschee gehen, denkt er, dass sie mit dem Gebet nur ihre Angst vor der Absurdität des Lebens übertünchen wollen. Auch das freitags so nachlässige Äußere der Gläubigen, das er von seinem Balkon aus beobachtet, mag Haroun nicht und er wundert sich, dass sie in Schlafanzug und Pantoffeln zum Gebet gehen, als seien an diesem Tag alle Benimmregeln außer Kraft gesetzt. Und von einem Gott, der Unterwerfung fordere, selbst aber noch nie einen Fuß auf die Erde gesetzt habe und sich schon gar nicht um die Lebensfragen der Menschen kümmere, hält er gar nichts.
Haroun ist gleichgültig gegen den algerischen Widerstand, er kämpft nicht mit, hilft nicht, auch wenn er im Dorf deswegen argwöhnisch beäugt wird. Als er dann doch einen Franzosen tötet, so ist das schon ein paar Tage nach der Unterzeichnung der Unabhängigkeit. Sein Mord ist nun kein heroischer Akt des Widerstands mehr, wie er es noch eine Woche vorher gewesen wäre, sondern tatsächlich nur eine wahllose Rache.
Kamel Daoud knüpft in seinem Debütroman an die Geschichte Meursaults an und transformiert sie eine andere Zeit, in eine andere Kultur, hält dabei aber am narrativen Kern, der Philosophie des Absurden, fest. Vielleicht ist ihm dabei nicht DER Roman gelungen, den Camus vor siebzig Jahren geschrieben hat, indem er eine Geschichte, fast eine Parabel, erzählt, die in fast jeder Zeit und an jedem Ort spielen könnte. Daouds Geschichte ist ganz konkret in Zeit und Raum verankert; Daoud lässt seinen Protagonisten mündlich erzählen, sodass viele der Leerstellen, die wir bei Camus finden und die dort zu Deutungen anregen, nun gefüllt sind. Aber auch wenn Daouds Text so anders gestaltet ist, so ist er doch durch die Verortung in einer anderen Kultur, die Spiegelung der die Motive und Verweise und immer wieder durch das Spiel mit Camus´ Erzählung und der philosophischen Diskussion des Existenzialismus, ein überaus gelungener Roman.
Kamel Daoud (2016): Der Fall Meursault – eine Gegendarstellung, aus dem Französischen übersetzt von Claus Josten, Köln, Kiepenheuer & Witsch
Hier könnt Ihr ein Interview mit Kamel Daoud anschauen, hier eine Rezension lesen und hier eine weitere.