Vor ein paar Wochen erst hat Samuel Hamen in seinem auf tell-review erschienenen Artikel „Gefährliche Leibschaften“ über das aktuell so vielfältige Phänomen des autobiographischen Schreibens nachgedacht. Angesichts der zunehmenden Unübersichtlichkeit der medialen Berichterstattung, in der selbst der Kundigste auch einmal bewussten Fakes auf den Leim gehe, suchten, so die These Hamens, die Leser Sicherheit im Authentischen. Sie ließen sich ganz besonders begeistern und anrühren durch Texte, bei denen „das Schreiben durch den Körper“ verbürgt sei, von Autoren, die „ihre Lebensbeutelungen unverhohlen als biografische Narrative verwerten“, die „behaupten, ihr Leben 1:1 in Literatur zu transportieren.“ Diese Autoren tragen, so deutet es Hamens, selbst zu ihrer Legendenbildung bei und werfen dafür alles in die „Waagschale: ihr Familienglück, ihr Renommee, ihr Schreibtalent und ihren schriftstellerischen Körper.“
Genau in diese Kategorie passt auch Thomas Melles Buch „Die Welt im Rücken“. Hier beschreibt Melle die Ursachen, Wirkungen und Verheerungen seiner manischen Depression, auch Bipolarität genannt. Nicht in Form eines Romans, sondern in der des autobiographischen Schreibens erzählt Melle von den Jahren 1999, 2006 und 2010, in denen die Krankheit ihn immer ein Stück mehr heruntergezogen hat, mit immer längeren manischen Phasen und den immer doppelt so lange wirkenden Abstürzen in die Depression. Den sozialen, geistigen und körperlichen Beschädigungen, unterstützt auch durch paranoide Phasen und ausgeprägten Alkoholkonsum, steht der gesellschaftliche Abstieg zur Seite – am Ende ist Melle obdachlos, hoffnungslos überschuldet, rettet sich von einem Heim ins nächste, ein Betreuer, der seine Finanzen ordnen und regeln soll, ist ihm zur Seite gestellt.
Hat Melle also ein Buch geschrieben, dass auf die Suche der Leser nach wahrhaften Geschichten reagiert, das so einen finanziellen Erfolg verspricht, auf den Voyeurismus der Leser vertraut und das eigene Renommee und Schreibtalent opfert? Oder liegt hier doch ein Text vor, der insofern wichtig ist, als dass er in literarischer Form die Abgründe einer Krankheit beschreibt, dem Leser so, auf eine poetische Weise versucht nahezubringen, wie es sich anfühlt, wenn die überschießenden Neuronen Salti schlagen – und eben gerade nicht als staubtrockene „Krankheitsakte“, von denen hier und da und immer wieder in Zusammenhang mit diesem Buch zu lesen ist.
Nun, dass Melle mit seinem Buch sein Renommee aufs Spiel setzte, ist eher nicht zu vermuten. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist sogar eine der „Nebenwirkungen“ seines Textes, dass diejenigen ein wenig Verständnis für seine Taten und Handlungen aufbringen können, denen er in manischen Phasen zu viel zugemutet hat. Seinen Freunden zum Beispiel, die er immer wieder ordentlich vor den Kopf gestoßen hat, wenn er sich – mehrfach – selbst aus der Psychiatrie entließ, in die sie ihn mühsam und aus Sorge gebracht hatten, indem er sich gar in paranoiden Phasen von ihnen verfolgt fühlte, indem sie in den depressiven Phasen so für ihn sorgen mussten, dass es ihnen irgendwann einfach zu viel wurde, indem er also ihre Geduld, ihre Freundschaft und ihre Fürsorge so strapazierte, bis er sich schließlich ziemlich alleine wiederfand.
Und Ulla Unseld-Berkéwicz, ein anderes Beispiel, seine Verlegerin, die ihn während des zweiten manschen Schubs 2006 mit Hilfe eines Suhrkamp-Stipendiums finanziell unterstütz hat. Der stößt er während einer Suhrkamp-Veranstaltung aus Ärger über die Verlagsentscheidungen und weil er sowieso meint, er müsse Suhrkamp retten, in der Rücken oder vor den eingegipsten Arm, das weiß er so genau nicht mehr, sodass der Verlag natürlich von einer weiteren Zusammenarbeit Abstand nimmt. Und dabei hat Melle sich so gefreut, als er endlich ein Suhrkamp-Autor geworden ist. Das sind die Beispiele für das ordentlich zerbrochene Porzellan, das er begutachten kann, wenn die Manie nachlässt, wenn das Neuronengewitter aufhört. Und nahtlos übergeht in die Talfahrt Richtung Depression, die den Blick auf diesen Scherbenhaufen, der ohnehin voller Scham und Schuld ist, noch mehr befeuert. Renommee und Familien- oder Freundesglück kann er durch dieses Buch also gar nicht mehr verlieren.
Es ist ja hier genau anders: Indem Melle versucht, mit der Sprache für Außenstehende deutlich zu machen, wie das Gedankenkarussell kreist, welche völlig verstiegenen Ideen auftauchen, wie die Krankheit den eigenen Geist beherrscht, ja, die Persönlichkeit geradezu übernimmt, indem er von diesen Wirrnissen in einer anschaulichen, in einer geradezu poetischen Sprache erzählt und berichtet, indem er also sein Schreibtalent nutzt, um aufzudecken und verständlich zu machen, was in Zeiten des Wahns passiert, schafft er gerade den Ansatz zu einem vertiefteren Verständnis für diese Erkrankung: „Also muss ich erzählen, um es begreifbarer zu machen.“
Da mag der Leser zu Beginn noch schmunzeln über den Hinweis, dass Melle Sex mit Madonna hatte und auch mit Björk, die ihm aber mehr und mehr auf die Nerven ging. Jeden Liedtext bezieht er auf sich, bei jeder Äußerung, auch von völlig Fremden, die er im Vorbeigehen aufschnappt, fühlt er sich gemeint. Das Schmunzeln vergeht dem Leser aber sehr schnell, wenn er die Verrücktheiten weiterliest, wenn er darüber liest, dieses Motiv kommt immer wieder in allen drei mansischen Schüben, dass Melle sich auch für das Weltgeschehen insgesamt verantwortlich fühlt. Hier scheint es jedoch eine Wahrheit zu geben, so bildet er sich ein, die er sich erst selbst erschließen muss. Und dann meint er tatsächlich, dass in „meinem Namen (…) das größte Menschenverbrechen seit jeher begangen worden [ist], noch bevor ich auf die Welt gekommen bin.“ Denn „letztendlich hatte Hitler nämlich gedacht, er wäre ich – so ich in meinem Wahn.“
Es ist zutiefst beeindruckend, wenn Melle erzählt, wie der Wahn ausbricht, in Sekunden, wie er spüren kann, was da in seinem Kopf in seinem Körper passiert:
„Es beginnt also mit einem Gefühlsüberschuss. Ein Schock fährt durch die Nerven, Kaskaden von ungerichteten Emotionen schießen hinab und schwappen wieder hoch. Die Empfindung völliger Haltlosigkeit stellt sich ein. Unter der Haut wird es heiß. Der Rücken brennt, die Stirn ist taub, der Körper leer und gleichzeitig übervoll: Neuronenschwemme. (…) Das System beginnt von einem winzigen, mutierenden Detail ausgehend, zu wuchern wie ein irres Fantasiegebäude. Es wandelt sich ständig, morpht sich, wie in einer Cunningham´scher Animation, rasant durch vielfältige Formen. (…) Ein unaufhaltsamer Prozess der Weltenbildung und der Weltenvernichtung ist im Gange.“
Und ein Prozess, bei dem der Mensch sich, offensichtlich bei vollem Bewusstsein, mehr und mehr selbst verliert, okkupiert wird durch den Wahn, der Stück für Stück die Oberhand übernimmt über Persönlichkeit und Körper. Das ist beeindruckend erzählt, oft auf verschiedenen Ebenen, nämlich auf einer reflektierenden, einer unmittelbar erlebenden und, vor allem auch mit Blick auf die Hintergründe der Krankheit, auf einer sachlich erklärenden Ebene was den Forschungsstand der Krankheit angeht, auch, was die Zumutungen der eigenen Biografie angeht, auch Auslöser sein können für die Bipolarität.
Zu diesen irren Ideen, Vorstellungen, Gewissheiten kommt eine Unruhe, die Melle ganze Tage und Nächte durch Berlin rennen lässt, hierhin und dorthin, ohne Plan, aber immer mit ganz viel Alkohol. In den manischen Phasen, so Melle, „rast die Zeit. Jeder Tag fetzt an einem vorbei, nein, man fetzt vielmehr durch die Tage hindurch. Die Eindrücke sind zahllos, die Reize grell, die Schlafeinheiten kurz.“
Auf den Leser wirken diese Parforceritte anschaulich, gewähren einen tiefen Einblick – und sind doch auch fordernd und abweisend, sind anstrengend zu lesen, weil es manchmal kaum auszuhalten ist. Trotzdem, wahrscheinlich, weil es immer wieder diese reflektierende Stimme gibt, kann man kaum glauben, dass hier ein Mensch, der so nachdenklich und besonnen schreibt, die Kontrolle über sein Leben verloren hat, völlig überschuldet ist, obdachlos, Entscheidungen nur noch mit Hilfe von Betreuern treffen kann. Hier ist der Erzähler dann auch gesellschaftlich sichtbar ganz unten angekommen.
Hat Melle hier sein Leben 1:1 in Literatur umgesetzt, vorausgesetzt, dass der Leser sich nur für ein so ehrliches Schreiben interessiert, vorausgesetzt, dass der Leser zum Voyeur werden möchte? Eher nicht. Hier schreibt ein Autor bewusst, hier wählt er ganz genau aus, was er erzählt, bringt die Inhalte in eine ganz bestimmte Form. Damit treibt er eine Art Literarisierung voran, auch wenn die eigene Geschichte immer die Schatzkiste bildet, aus der er auswählen kann. Und er weiß auch, selbst wenn er schreibt, dass die Fiktion pausieren muss, dass sie „hinterrücks“ natürlich fortwirke.
Am Ende dieses schmerzhaften Prozesses, in dem Melle ja auch eine Selbstvergewisserung vorantreibt, meint Melle erkannt zu haben, dass er wohl nur durch diese Krankheit geworden ist, was er ist: „Die Krankheit hat mich auf ewig gebrochen. Vielleicht hat sie mich aber auch, gegen meinen Willen, erst zum Schriftsteller gemacht.“ Und auch seine Bibliothek wächst wieder, fängt langsam an, die vielen Bücher zu ersetzten, die er über die Jahre seines Lebens angesammelt hat, um sie dann in den manischen Phasen Stück für Stück zu verkaufen, bis kein Buch mehr da war. Nun wächst sie wieder, die Bibliothek, die Welt in seinem Rücken.
Thomas Melles beeindruckendes Zeugnis seiner bipolaren Erkrankung und alles andere als eine „gefährliche Leibschaft“ ist mein zweiter Favorit für den Deutschen Buchpreis 2016 gewesen.
Thomas Melle (2016): Die Welt im Rücken, Berlin, Rowohlt Berlin Verlag.

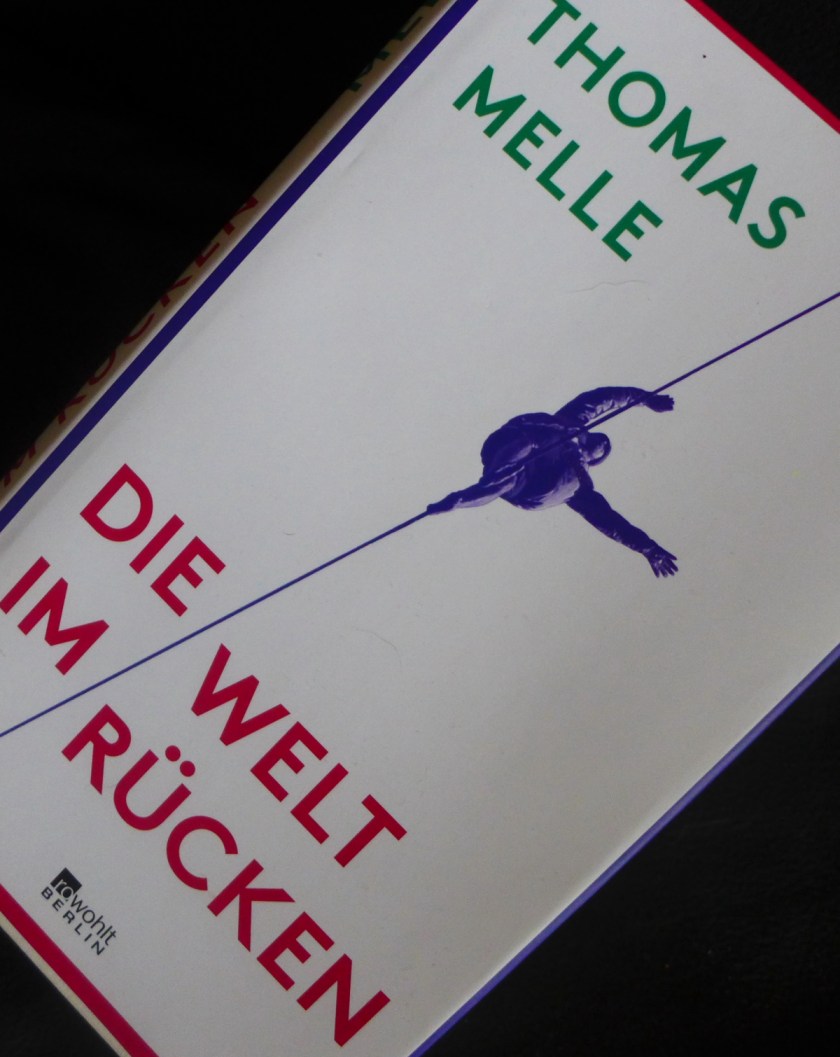
Das Buch ist zweifelsohne interessant, liefert eine spannende Introspektion. Aber ich finde diese Ichhaltigkeit, diesen Narzißmus stilistisch stellenweise unerträglich; das wird ab einem bestimmten Punkt unliterarisch und grauenhaft – zumal mich vieles im Ton an die Goetz/Bernhard-Schreibe erinnert. Stößt leicht unangenehm auf. Insofern ist die Entscheidung grundfalsche gewesen, diesen Text für den Buchpreis zu nominieren. Aus literarischen Gründen, denn diese Prosa ist ja im Grunde als Roman konzipiert, auch wenn sie versichert, sie sei keine Literatur, sondern wahrhaftig. Alter Montauk-Trick. Aber es paßt diese Literatur in die heutige Zeit. Dagegen war das, was man in den 70er, 80er Jahren die Neue Subjektivität nannte, mit so fragwürdigen Protagonisten wie Karin Struck oder Svende Merian, aber ebenso mit Autoren wie Handke und Max Frischs „Montauk“ – einem Text, der wahrsprechen wollte und die Realität doch ganz und gar literarisch bannte – fast eine Erholsamkeit. Begreifen muß man aber die Tendenz, die hinter diesem großen Ich steckt – beim Knausgard-Kult angefangen. Das hat gesellschaftliche Ursachen. Angesichts dessen, daß politische Optionen des Widerstands als verbaut erscheinen. Nicht anders als die Nachwehen der 68er, die sich in jener Neuen Subjektivität entluden. „Kein Ort. Nirgends“.
Clemens Meyer muß man von dieser Tendenz zur Autobiographie allerdings ausnehmen. Meyer erzählt. Und das ist in „Als wir träumten“ keine Ich-Geschichte, sondern die Wendezeit pur. Autoritäten, die wegbrachen, Freiheit, die sich als Illusion erwies. Große Literatur. Anders als dieses Buch von Melle.
Lieber Lars,
vielen Dank für deinen langen Kommentar, der – endlich einmal – Anlass gibt für eine ausführlichere elektronische Diskussion, die doch so selten zustande kommt.
Wahrscheinlich werden wir uns wegen der Beurteilung von Melles Text nicht einigen können. Und das finde ich auch völlig richtig, denn es ist ja gerade die Besonderheit von literarischen Texte, ganz unterschieldiche Wirkungen entfalten zu können. Eine Diskussion darüber – ganz dezidiert ohne das Ziel, sich einigen und eine gemeinsame Sicht enwickeln zu wollen – kann ja Lesarten vertiefen und außerdem Themen hinter dem Text aufdecken. Und das ist hier die sehr interessante Diskussion um die Tendenz zur Autobiographie im Text. Da sind zum einen die Autoren, die „Autobiographisches“ mit großem Erfolg veröffentlichen, da ist zum anderen eine Öffentlichkeit, die kaum erträgt, dass eine Autorin seit vielen Jahren ihr Pseudonym bewahrt (Ferrante).
Gerade heute hat Jutta Reichelt auf ihrem Blog aus der Sicht der Schriftsteller über das Phänomen des autobiographischen Schreibens nachgedacht und sehr deutlich aufgezeigt, wie das Schreiben über das selbst Erlebte und das Schreiben über Fiktives ineinanderragen und sich kaum differenzieren lassen: https://juttareichelt.com/2016/10/24/ist-das-autobiographisch-ueber-eine-erstaunlich-schwer-zu-beantwortende-frage/. Diese Position Juttas teile ich sehr, das habe ich ja auch in meinem Text zu Melle versucht deutlich zu machen, insofern, als dass Schriftsteller eben nicht 1:1 ihr Leben aufschreiben.
Nun könnte man auch noch darüber nachdenken, dass ein Text ja auch beim Leser wieder entschlüsselt wird und bei dieser Entschlüsselung ziemlich sicher eigene Erfahrungen, Werte, Ideen, Vorlieben und Abneigungen eine Rolle spielen, das sich der Leser also immer auch einen ganz eigenen, selbst konstruierten Text erschließt. Und an dieser Stelle entstehen dann wahrscheinlich, trotz aller literarischen Kriterien, solche unterschiedlichen Lese-Beurteilungen.
Aufeiner weiteren Ebene, und das hast du ja auch noch einmal in deinem Kommentar deutlich gemacht und so ist es ja auch in Samuel Hamens Beitrag zu lesen, fallen Texte, die das Attribut „autobiographisch“ tragen, auch in eine ganz bestimmte gesellschaftliche – und auch eine erwerbswirtschaftliche – Verfasstheit. Dies zeigen ja auch sehr eindrücklich die Bilder-Galerien, die Hamen zeigt und die deutlich machen, dass Autoren – wahrscheinlich ein neueres Phänomen der Medialisierung – ihre Texte auch mit dem eigenen Körper verkaufen (müssen). Weil auf der anderen Seite Leser sind, die dann 1:1 für Wahrheit halten, was sie lesen und das auch besonders mögen. Die immer fragen, auch davon schreibt Jutta, welche Teile des Romans denn auch wirklich selbst erlebt seien. Die also ganz besonders neugierig sind auf autobiographische Bücher. Und die diese Bücher dann aben auch in großem Maße kaufen. Der autobiogarphische Text also als besonders gut verkaufbare Ware, vor allem, wenn es auch noch um Krankheiten geht?
Ich kann und möchte diese Richtung nicht mit denken, zu schnell (das ist vielleicht der verstellte Blick einer auch Wirtschaftswissenschafterin) klingelt dann meine imaginäre Kasse und ich sehe nur noch die Verkaufszahlen. Mir ist wichtiger, den Text zu sehen, auch ohne Blick auf das übrige Leben des Autors, und den Text besonders in den Blick zu nehmen.
Du schreibst, dass dir die „Ichhaltigkeit“, der „Narzißmus“ unerträglich war. Wie müsste denn ein Text über eine manische Depression gestaltet sein, dass diese Aspekte ausgeschlossen wären? Oder lehnst du grundsätzlich Texte ab, die sich mit Krankheiten/Introspektiven beschäftigen? Wäre eine Erzählung, ein Roman eher geeignet?
Viele Grüße, Claudia
Viele interessante Aspekte, die Du nennst. Danke auch für den Link auf den Text von Jutta. Ich fange mal mit dem letzten Absatz an, weil ich denke, daß da die Crux liegt. Vielen brennt das Thema Depression unter den Nägeln. Es ist ohne Frage wichtig, weil es viele betrifft, und es ist vor allem dringend, dieses Thema einerseits aus der Schweigeecke zu holen. Und da liegt bereits mein erster Kritikpunkt: Mir ist Melles Text zu sehr auf Effekt geschrieben. Man sieht ihm an, daß er nicht bloß einen „ehrlichen“ (Leidens-)Bericht schreiben will, sondern er möchte unter dem Kleid der Authentizitätstexte im Grunde Literatur machen – was völlig in Ordnung ist. Mir geht es in meiner Bewertung solcher Prosa ähnlich wie bei Strunks Honka-Roman. So eindringlich Strunk diesen Mann und sein Milieu beschreibt, so sehr führt er am Ende doch diesen armen Mann vor und mißbraucht ihn im Grunde für eine eigene Sache, für seine typischen Strunk-Witze, die man genauso in anderen Büchern von ihm findet. Für Leute wie Strunk ist dieses Milieu nur schick. Sie haben jeden Tag die Möglichkeit, wieder auszusteigen und in ihre biedere Wohnung in der Schanze zu gehen. Für die, die da leben: Die bleiben. In beiden Büchern stimmt etwas nicht. Nun kann man Melle freilich nicht den Strunk-Vorwurf machen, denn er hat diese Krankheit. Beide Bücher ähneln sich jedoch in ihrer Eitelkeit. (Zumindest in meiner Sicht, das kann man sicherlich auch anders betrachten.)
Ich kann meine Vorbehalte eigentlich nur in knappen Skizzen angeben – ich werde zu meinen Eindrücken bei mir im Blog noch eine separate Kritik schreiben: Aber mir ist der Ton von Melle zu sehr gewollt, vielfach stößt mir in den Formulierungen eine Originalitätssucht auf, ein Ton, den ich zu oft schon gehört habe. Dieses 90erJahre-Überkomplexitätsding, die Zeichendeutungsrhetorik der Foucault- und Barthes-Jünger. Dazu dann dieses ewiggleiche Berlinkolorit. Klar, er umgeht die Kritik daran trickreich, in dem er seinen Text als authentisch markiert. Und da kann man dann kaum etwas gegen sagen, denn Melle lebt nun mal in Berlin. Da kommt das Authentische gut zupaß. Ich nehme es Melle nicht ab, daß es ihm einzig um ein Buch über Depression geht.
Was stört mich an diesem Text? Es erinnern mich Ton und Stil sehr an Rainald Goetz, und da lese ich dann doch das Original lieber als die Kopie. Erzählen kann Melle zwar. Ich habe anfangs viel gelacht, obwohl es oft traurig war. Er fängt diese Zeit der späten 90er, diese ersten Internetaktivitäten gut ein. Aber immer wieder merke ich, daß ich mich am Melle-Stil störe. Er hat etwas im unangenehmen Sinne Outriertes. Und ich habe eigentlich nach 100 Seiten diesen Ton über. Das Originelle verpufft im Dauerfeuerwerk.
Was Ferrante betrifft, sehe ich es ähnlich. Bis zu dem Punkt hin allerdings, wo Ferrante eine Autobiographie schreiben will. Ich verlinke mal auf meinen Artikel dazu:
https://bersarin.wordpress.com/2016/10/07/der-fall-ferrante-oder-neapel-ist-ein-text/
An dieser Stelle wird es problematisch. Im Möglichkeitssinn, wie Jutta Reichelt Musil zitiert, geht alles. Aber wo sind die Grenzen, wenn es um Biographien geht? (Ich bin da nicht orthodox und habe in diesen Dingen ein weites Herz, finde sowieso Masken, Spiele und Verkleidungen reizvoll.)
In der Tat bedeutet Literatur nie im Modus eins-zu-eins sein Leben abzupinseln. Darin sind wir uns einig. Obwohl das Leben doch immer mit ins Buch ragt, man denke an diejenigen, die sich in Thomas Manns „Zauberberg“ getroffen fühlten oder an Maxim Billers „Esra“. Obwohl auch dieser Versuch, ein reales Leben zu (be)schreiben bereits als Fiktionsstrategie mit Authentizitätsbeteuerung immer wieder durchexerziert wird. Ein Leben in Literatur zu verwandeln, das Leben als Leben in Literatur am Leben zu lassen. (Aber geht das?) Literatur kann zugleich ein confessio sein, Max Frisch zitiert zu Beginn seines „Montauk“ Montaigne:
„Dies hier ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Es warnt dich schon beim Eintritt, daß ich mir darin kein anderes Ende vorgesetzt habe als ein häusliches und privates. Ich habe darin gar keine Achtung auf deinen Nutzen noch auf meinen Ruhm genommen.“
Für den letzten Teil des letzten Satzes würde ich bei Melle nicht meine Hände ins Feuer packen. Das Buch hat etwas Eitles. Und vielleicht ist es gerade das, was mich daran stört. Obwohl ich es nicht ungerne gelesen habe.
Viele Grüße, auch von mir.
Liebe Claudia, jetzt geht es mir ganz ähnlich wie dir: ich muss erstmal den teil-Beitrag nachlesen und vermutlich ein bisschen nachdenken – dann melde ich mich wieder 😉
Vorweg: Ich bin erstaunt, wie schwer es mir gerade fällt die diversen Ebenen oder Fragen, die hier eine Rolle spielen, auseinanderzuhalten – selbst wenn ich „nur“ bei diesem einen Text von Thomas Melles bleibe.
Nochmals (und eventuell überflüssig) vorweg: Ich glaube immer weniger, dass ein Text, sobald er nur ein gewisse Qualität erreicht, für nahezu jede Leserin, jeden Leser als ein „guter Text“ lesbar sein müsse. Ich habe dazu vor wenigen Tagen bei Austin Kleon (http://austinkleon.com/2016/10/18/it-wasnt-for-me/) dieses Jorge Luis Borges-Zitat samt umgebender Anekdote gelesen: “If a book is tedious to you, don’t read it; that book was not written for you.” und, liebe Claudia, wir hatten ja dieses Thema schon einmal ausführlicher und für mich sehr erhellend.
Was mich an deinen Gedanken, Lars, am meisten beschäftigt ist die Frage: Welche Rolle spielt darin der Autor und welche der Text? Offenbar sind es ja nicht zuletzt die Annahmen über den Autor, die den Text beschädigen. („Ich nehme es Melle nicht ab …“). Das wäre bei einem „normalen Roman“ vermutlich ja anders. Da würde dich „nur“ der Ton stören. (Ich kann das absolut nachvollziehen, ich kann auch manchen Ton nicht ertragen und breche deswegen die Lektüre ab – bei Melle ging es mir nicht so).
Und ich frage mich, welche Vorstellung von Aufrichtigkeit wir vernünftigerweise haben können? Würde Melle womöglich aufrichtiger wirken, wenn er sich verstellen würde?
Vielleicht soviel für den Moment – mit Grüßen an euch beide!
Pingback: Neu in unseren Bücherregalen: Oktober 2016 | Gemeindebücherei Marienheide
Pingback: Blogbummel Oktober 2016 – Teil 2 – buchpost
Das Buch ist Narzissmus. Sehr gut geschrieben, aber reine Selbstbeschau. Darum langweilig auf die Dauer. Ich wage die These und glaube, bipolare Störung ist ein westliches Phänomen.